- Dein Warenkorb ist leer.
Unterhalt bei ausgedehntem Umgang mit dem Kind
Mehr Kinderbetreuung – Weniger Unterhalt?
Standort :
Kanzlei für Familienrecht > Scheidung München > Infothek zum Familienrecht > Unterhalt für Kinder > anteilige Haftung der Eltern > Unterhaltspflicht bei Mitbetreuung
Mehr Kinderbetreuung – Weniger Unterhalt?
Erfahren Sie, wie eine erweiterte Betreuung Ihres Kindes Einfluss auf die Unterhaltszahlungen haben kann. Wenn Sie als unterhaltspflichtiger Elternteil mehr Zeit mit Ihrem Kind verbringen, könnten sich Ihre Barunterhaltsverpflichtungen reduzieren. Informieren Sie sich über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten, den Kindesunterhalt fair zu gestalten.

Im Folgenden geht es um die Frage, wie die Barunterhaltspflicht zu bemessen ist, wenn der Betreuungsanteil über das Residenzmodell hinausgeht, aber noch nicht von einem echten Wechselmodell gesprochen werden kann.
| Wegweiser zum Kindesunterhalt und Betreuungsmodell
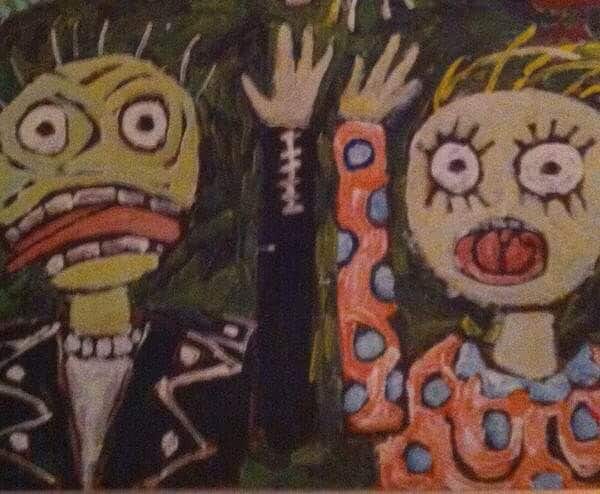
Praitätisches Wechselmodell: In diesem Ratgeber erfahren Sie alles über den Kindesunterhalt, wenn die Kinderbetreuung hälftig zwischen den Eltern aufgeteilt ist.
| Wegweiser zum Kindesunterhalt beim paritätischen Wechselmodell
Das Wichtigste in Kürze
- Das Interesse von Vätern an einem ausgedehntem Umgangsrecht bis hin zur Mitbetreuung der Kinder wächst stetig. “Wochenend- und Ferien-Papa” sein ist vielen Vätern nicht mehr genug.
- Je ausgedehnter der Umgang mit den Kindern ist, desto höhere Betreuungskosten entstehen dem barunterhaltsplichtigen Elternteil. Nur beim Umgang mit dem Kind nach Maßgabe des Residenzmodells spricht man von Umgangskosten. Wird ein darüber hinausgehender Umgang mit dem Kind gepflegt, spricht man von Kosten der Mitbetreuung.
- Wie geht das Unterhaltsrecht mit Umgangskosten um, die beim umgangsberechtigten Elternteil (meist Väter) anfallen? Das hängt vom Umgangs- / Betreuungsmodell ab.

Inhaltsverzeichnis | Wegweiser zum Kindesunterhalt und Betreuungs-Modelle
Recht auf Mitbetreuung
Aktuell ist festzustellen, dass zwei Drittel der Elternkonflikte zugunsten der Mütter entschieden werden. Nach Art. 6 Abs.4 GG haben Mütter ein Anspruch auf den Schutz und Fürsorge durch die Gemeinschaft. Nach einem verfassungsrechtlich hervorgehobenem Schutz von Vätern kann man lange suchen und wird nichts finden. Dies mag als Relikt einer durch die Realität überholten Gesellschaftsordnung erscheinen.
Im Jahr 2010 entschied das Bundesverfassungsgericht, der Ausschluss des leiblichen Vaters vom Sorgerecht ist verfassungswidrig.
Die Bundesrepublik musste sich vom Europäischen Gerichtshof im Jahr 2011 erklären lassen, dass der Ausschluss Umgangsrechts für leibliche Väter die Menschenrechte von Vätern (Art. 8 EMRK) verletzt. Seit dem Jahr 2013 haben “nur” leibliche Väter, die nicht “gesetzliche Väter” sind, ebenfalls Anspruch auf Umgangsrecht und Sorgerecht.
Es ist eine Schande in der Landschaft des deutschen Familienrechts, dass derzeit im Interesse von Vätern nur gehandelt wird, wenn der Europäische Gerichtshof oder das Bundesverfassungsgericht Verstöße gegen Menschenrechte oder gegen Grundrechte anmeldet. Seit dem Jahr 2016 kippt das BVerfG laufend Entscheidungen des BGH zum Kindschaftsrecht.
Wo ist in Deutschland die Lobby der Väter, die sich um die Erziehung Ihrer Kinder kümmern will und in der Lage ist, dafür politischen Druck auszuüben? Wir kennen keine!
Mama und Papa gleich viel
Manchmal tönt es durch die Presse: “Väter sind den Müttern inzwischen (fast) völlig gleichgestellt”. Ist das im deutschen Familienrecht wirklich der Fall? Wir haben unsere Zweifel! In anderen Ländern der Europäischen Union ist es völlig normal, dem Vater ein grundsätzliches Erziehungs- und Betreuungsrecht zuzusprechen. Der deutsche Gesetzgeber kennt keine klare Entscheidung für das Wechselmodell. Seit seiner Entscheidung aus dem Jahr 2017 erklärt der BGH, dass es auch keine gesetzgeberische Entscheidung gegen das Wechselmodell gibt.
| Anspruch auf Wechselmodell?
Somit werden sich die gerichtlichen Verfahren von Vätern zur Durchsetzung paritätischer Betreuungsmodelle häufen. Interessenverbände zur Stärkung von flexiblen Betreuungsmodellen bestehen bereits national und international
| Mama und Papa gleich viel
Kosten der Mitbetreuung
Kinderbetreuungskosten
Betreuungskosten, die beim überwiegend kinderbetreuenden Elternteil anfallen, werden als Kinderbetreuungskosten bezeichnet.
Betreuungskosten, die beim anderen Elternteil anfallen (barunterhaltspflichtiger Elternteil) werden als Umgangskosten bezeichnet.
Die Betreuungskosten werden unterhaltsrechtlich völlig unterschiedlich erfasst und behandelt, je nachdem, ob sie beim kinderbetreuenden oder beim umgangsberechtigten Elternteil anfallen und welches Kinderbetreuungsmodell die Eltern nach der Trennung mit ihren Kindern pflegen:
| Kinderbetreuungskosten – Bedarf des Kindes oder berufsbedingter Aufwand des betreuenden Elternteils?
Umgangskosten
Wenn die Betreuungskosten zum Bedarf des Kindes zählen, wird weiter gefragt, welchen Einfluss hat eine Mitbetreuung des Kindes durch den barunterhaltspflichtigen Elternteil auf die Höhe seiner Barunterhaltspflicht hat. Die Mitbetreuung kostet Geld (Kosten für Freizeitaktivitäten, Übernachtungskosten, Lebensmittelkosten etc.). Je nach Betreuungsmodell und Umfang des Betreuungsanteils beider Eltern an der Kinderbetreuung können die Umgangskosten sich auf die Höhe der Barunterhaltspflicht auswirken:
- Betreuung im Residenzmodell:
Wird der Umgang mit dem Kind im Rahmen eines Residenzmodells gepflegt, werden Umgangskosten unterhaltsrechtlich grundsätzlich nicht berücksichtigt:
| Kinderbetreuung nach dem Residenzmodell - Mitbetreuungsmodell:
Pflegen die Eltern ein vom Residenzmodell abweichendes Mitbetreuungsmodell, so beeinflussen die Umgangskosten des barunterhaltspflichtigen Elternteils die Ermittlung des Barunterhalts:
| Kindesunterhalt bei ausgedehnter Mitbetreuung
Kinderbetreuung nach dem Residenzmodell
Umgangskosten muss der barunterhaltspflichtige Elternteil zusätzlich zum Barunterhalt grundsätzlich selbst tragen
Haben sich die Eltern getrennt, geht der Gesetzgeber davon aus, dass der Umgang und die Kinderbetreuung im Rahmen eines Residenzmodells erfolgt. Danach ist meist die Mutter der alleinerziehende Elternteil. Der Vater hat mit dem Kind Umgangskontakte im üblichen Rahmen zwischen ca. fünf und zehn Tagen/Monat. In diesem Fall bestimmt sich die Unterhaltslastenverteilung zwischen den Eltern nach § 1606 Abs.3 S.2 BGB. Die mit dem Umgang des Kindes verbunden Kosten (Umgangskosten), hat beim Residenzmodell grundsätzlich jeder Elternteil, selbst zu tragen.

BGH, Urteil vom 21.12.2005 – XII ZR 126/03
Umgangskosten im Rahmen üblicher Umgangskontakte
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat) “Da die im Rahmen üblicher Umgangskontakte von etwa fünf bis sechs Tagen monatlich gewährte Verpflegung nicht zu Erstattungsansprüchen des besuchten Elternteils führt, sondern dieser die üblichen Kosten, die ihm bei der Ausübung des Umgangsrechts entstehen, grundsätzlich selbst zu tragen hat (vgl. Senatsurteil vom 23. Februar 2005 – XII ZR 56/02 – FamRZ 2005, 706, 707 f. m.w.N.), führt die Verpflegung während weiterer vier bis fünf Tage nicht zu nennenswerten Ersparnissen des anderen Elternteils.
Anmerkung:
Der barunterhaltspflichtige Elternteil kann weder sein unterhaltsrelevantes Einkommen noch die Höhe des Barunterhalts um die Umgangskosten kürzen. Die Vorstellung vom Residenzmodell liegt der Düsseldorfer Tabelle (DT) zu Grunde. Die DT hat insofern in den Tabellenbeträgen die üblichen Umgangskosten einkalkuliert (BGH, Beschluss vom 12.03.2014 – XII ZB 234/13, Rn 35). Nach der Vorstellung des Residenzmodells pflegt der Barunterhaltspflichtige einen Umgang mit dem Kind
- an jedem zweiten Wochenende und
- in der Hälfte der gesamten Schulferienzeit
- Der Regelumgang weist somit einen Umfang von 29 % der gesamten Jahreszeit auf.
Ist der Kinderbetreuungsanteil so nicht höher als 29 % der Jahreszeit, wird nicht von einem ausgedehnten Umgang oder ausgedehnter Mitbetreuung des Kindes gesprochen. Einen Anspruch auf Kostenbeteiligung des anderen Elternteils an den Umgangskosten besteht nicht. Man spricht vom ausgedehnten Umgangsrecht bei über 30 % bis 50 % Mitbetreuungsanteil.
Das Kinderzimmer beim barunterhaltspflichtigen Elternteil:
Dies gilt auch für Kosten, die für das Bereithalten eines Wohnraums für Übernachtungen des Kindes entstehen (vgl. BGH, Beschluss vom 12.03.2014 – XII ZB 234/13, Rn 35).
Wann mindern Umgangskosten die Barunterhaltspflicht?

BGH, Urteil vom 23.02.2005 – XII ZR 56/02
Wann reduzieren Umgangskosten die Barunterhaltspflicht?
Leitsatz:
“Die angemessenen Kosten des Umgangs eines barunterhaltspflichtigen Elternteils mit seinem Kind können dann zu einer maßvollen Erhöhung des Selbstbehalts oder einer entsprechenden Minderung des unterhaltsrelevanten Einkommens führen, wenn dem Unterhaltspflichtigen das anteilige Kindergeld gem. § 1612 b Abs. 5 BGB ganz oder teilweise nicht zugutekommt und er die Kosten nicht aus den Mitteln bestreiten kann, die ihm über den notwendigen Selbstbehalt hinaus verbleiben (im Anschluss an Senatsurteil vom 29. Januar 2003 – XII ZR 289/01 – FamRZ 2003, 445 ff.).“
Anmerkung:
Nur wenn der barunterhaltspflichtige Elternteil unter Berücksichtigung seiner Erwerbsobliegenheiten ausreichend Einkommen über dem Selbstbehalt erzielt (bzw. erzielen kann), muss er Unterhalt bezahlen (Leistungsfähigkeit der Eltern). Zieht man vom unterhaltsrelevanten Elterneinkommen des barunterhaltspflichtigen Elternteils dessen Umgangskosten ab und wird damit im Ergebnis der Selbstbehalt unterschritten, stellt man fest, dass sich der unterhaltspflichtige Elternteil sich faktisch den Umgang mit dem Kind nicht leisten kann (vgl. BGH, Beschluss vom 12.03.2014 – XII ZB 234, Rn 36; OLG Dresden, Beschluss vom 30.08.2019 – 20 WF 628/19).
Ein solches Ergebnis will der BGH tunlichst vermeiden und lässt in diesem Ausnahmefall eine Minderung des Einkommens um die Umgangskosten zu.

AG Meißen, Beschluss vom 04.06.2024 – R 6 F 151/23,
intern vorhanden, unser Az. 29/24
Außergewöhnlich hohe Fahrtkosten
Anmerkung:
Im Falle einer räumlichen Trennung der Eltern, in dem das Kind weit entfernt vom anderen Elternteil lebt, kann verlangt werden, dass der betreuende Elternteil das Kind zu einem vereinbarten Treffpunkt bringt. In einem Fall entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Mutter verpflichtet ist, das Kind zum Flughafen zu bringen und dort auch wieder abzuholen, wenn der Vater aufgrund von Zeitgründen fliegen muss (Beschluss vom 5.2.2002 -1 BvR 2009/00).
Im Fall überdurchschnittlich hoher Fahrtkosten, weil der Elternteil, bei dem das Kind lebt, vom anderen Elternteil weit weggezogen ist hat das AG Meißen (Beschluss vom 04.06.2024 – R 6 F 151/23, intern vorhanden) das Einkommen des barunterhaltspflichtigen Elternteils von den außergewöhnlich hohen Fahrtkosten bereinigt.
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat) “[…] Der Antragsgegner hat insoweit nachvollziehbar dargelegt, dass ihm im Schnitt entsprechende Kosten jedenfalls für den Umgang mit dem Antragsteller H. durchschnittlich monatlich entstehen. Angesichts der erheblichen räumlichen Distanz zwischen dem Umgangsort und den Aufenthaltsorten des Antragsgegners in Meppen bzw. in Brüssel begegnet die Höhe der abzuziehenden Kosten insoweit auch keinen Bedenken, da jedenfalls eine Unterhaltszahlung weit über dem Mindestunterhalt vorliegend dennoch außer Frage steht […]“
Abgezogen werden können aber nur die konkreten Mehrkosten, also die Mehrkosten einer Fahrkarte bzw. die zusätzlichen Benzinkosten, aber nicht etwa eine Kilometerpauschale. Wird durch die Fahrtkosten der Selbstbehalt des umgangsberechtigten Elternteils unterschritten, so ist der Selbstbehalt entsprechend zu erhöhen. In anderen Fällen kann bei besonders hohen Fahrtkosten eine Herabstufung in der Düsseldorfer Tabelle vorgenommen werden. Immer ist aber eine Angemessenheitsprüfung vorzunehmen: desto höher das Einkommen des umgangsberechtigten Elternteils ist, desto eher kann man von ihm verlangen, die Fahrtkosten in voller Höhe selbst zu tragen.

OLG Bamberg, Beschluss vom 09.02.2022 – 7 UF 196/21
Einkommensbereinigung wegen Umgangskosten bei Mindestunterhalt für Kinder
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat) “Zu bereinigen ist das (fiktive) Einkommen zudem um die Kosten, die dadurch anfallen, dass der Antragsgegner zweimal im Monat die Antragsteller zum Umgang abholt und zurückbringt (vgl. hierzu Klinkhammer in Wendl / Dose, a.a.O., § 2 Rn. 271; Grüneberg / von Pückler, a.a.O., vor § 1601 Rn. 15).
Unbestritten legt der Antragsgegner hierfür mit dem PKW pro Monat 544 Kilometer zurück. Im Hinblick darauf, dass es vorliegend um den gesetzlichen Mindestunterhalt geht und zudem bei dem Fahrzeug des Antragsgegners (Baujahr 2004; Kilometerstand: 283.000) ein weiterer Wertverlust durch die Fahrten nicht zu befürchten ist, berücksichtigt der Senat insoweit allerdings allein die tatsächlich anfallenden Benzinkosten. Ausgehend von einem durchschnittlichen Verbrauch von höchstens 6 Litern/100 Kilometer und durchschnittlichen Kosten von 1,60 € pro Liter Benzin dürften diese etwa 50 € im Monat betragen (§ 287 ZPO).
- Weiterführende Links:
» Eingeschränkte Einkommensbereinigung beim Mindestunterhalt für Kinder
Kindesunterhalt bei ausgedehnter Mitbetreuung
Barunterhaltsermittlung bei Mitbetreuung (Betreuungsanteil über 29 % aber unter 50 %)
Unter Kinderbetreuung im echten Wechselmodell versteht und erfasst der BGH die Fälle der tatsächlichen paritätischen Mitbetreuung. Hier teilen sich beide Elternteile die Kinderbetreuung zu 50 : 50. Weicht die Mitbetreuungsquote nur geringfügig davon ab (z.B. 47 % zu 53 %), liegt ein Fall der Mitbetreuung vor.
Der BGH behandelt die Barunterhaltspflicht im Fall eiens echten Wechselmodell anders als im Fall der Mitbetreuung. Das unechte Wechselmodell, d.h. die Form der Mitbetreuung unter einem Anteil von 50 % aber über einem Betreuungsanteil nach dem Residenzmodell, ist das Betreuungsmodell, das in der Praxis immer häufiger vorkommt.
Die Grenzen des Residenzmodells sind überschritten, wenn der Betreuungsanteil des barunterhaltspflichtigen Elternteils mehr als 29% des gesamten Betreuungsaufwandes ausmacht. Das Bedürfnis von Vätern nach mehr Mitbetreuung wächst in der heutigen Zeit stetig. Wie unterhaltsrechtlich damit umgegangen werden soll, ist u.a. auf der Herbsttagung der AG Familienrecht im Jahr 2018 ein viel diskutiertes Thema gewesen.
Die bislang gepflegten Lösungsansätze wirken unbefriedigend. Man versucht heute das Phänomen der unechten Wechselmodelle dadurch zu lösen, dass man eine Reduzierung die Barunterhaltspflicht nach Maßgabe der Düsseldorfer Tabelle durch Korrekturen an den Tabelle hinbekommt. Folgende Lösungsansätze bieten sich an:
- Einkommensgruppe & Umgangskosten
- Einkommensgruppe & Anzahl der Unterhaltslasten
- Einkommensgruppe & Bedarfskontrollbetrag.
Weiter wird eine Korrektur des Selbstbehalts oder die Berücksichtigung der Mitbetreuungskosten durch Abzug vom unterhaltsrelevanten Elterneinkommen vorgeschlagen. Letzteres ist der Fall, wenn die notwendigen Umgangskosten nicht über das Kindergeld abgedeckt werden. Dann sind z.B. hohe Fahrtkosten, notwendige Übernachtungskosten als unvermeidbare Schuld berücksichtigungsfähig und können zur Einkommensbereinigung führen, soweit Sie das anrechenbare Kindergeld übersteigen.
All diese Lösungsansätze werden vertreten, um den erhöhten Mitbetreuungsaufwand bei der Zahllast an Kindesunterhalt zu berücksichtigen. Es kann erst dann zu einer weiteren Kürzung der Barunterhaltslast kommen, wenn neben dem erhöhten Mitbetreuungsaufwand durch die persönliche Kinderbetreuung des barunterhaltsplichtigen Elternteil auch Teile des Bedarfs des Kindes an einer Geldrente durch Naturaunterhaltsleistungen gedeckt werden (vgl. BGH, vom 12. März 2014 – XII ZB 234/13). Konsequenz: Im Ergebnis muss der andere Elternteil durch die Mitbetreuung von eigenen Aufwendungen für das Kind finanziell spürbar entlastet sein.
- Weiterführende Links und Literatur:
» Gerhardt, Kosten des Umgangs als unvermeidbare Schuld, in: Wendl/Dose, Das Unterhaltsrecht in der familienrechtlichen Praxis, 10. Aufl. 2019, § 1 Rn 1085
» MüKoBGB/Born § 1603 Rn. 53 c mwN.
» Barunterhalt beim echten Wechselmodell
BGH zum Kindesunterhalt bei ausgedehnter Mitbetreuung

BGH, Beschluss vom 12. März 2014 – XII ZB 234/13
Bedarfsdeckender Mitbetreuungsaufwand reduzieren die Barunterhaltspflicht
Leitsätze:
a) Nimmt der barunterhaltspflichtige Elternteil ein weit über das übliche Maß hinaus gehendes Umgangsrecht wahr, kann der Tatrichter die in diesem Zusammenhang getätigten außergewöhnlich hohen Aufwendungen, die als reiner Mehraufwand für die Ausübung des erwei terten Umgangsrechts dem Anspruch des Kindes auf Zahlung von Unterhalt nicht als bedarfsdeckend entgegengehalten werden können (vor allem Fahrt- und Unterbringungskosten), zum Anlass dafür nehmen, den Barunterhaltsbedarf des Kindes unter Herabstufung um eine oder mehrere Einkommensgruppen der Düsseldorfer Tabelle zu bestimmen.
b) Der auf diesem Weg nach den Tabellensätzen der Düsseldorfer Tabelle ermittelte Unterhaltsbedarf kann (weitergehend) gemindert sein, wenn der barunterhaltspflichtige Elternteil dem Kind im Zuge seines erweiterten Umgangsrechts Leistungen erbringt, mit denen er den Unterhaltsbedarf des Kindes auf andere Weise als durch Zahlung einer Geldrente teilweise deckt (im Anschluss an Senatsurteile vom 21. Dezember 2005 – XII ZR 126/03 – FamRZ 2006, 1015 und vom 28. Februar 2007 – XII ZR 161/04 – FamRZ 2007, 707).
Anmerkung:
Der gängigste Weg in der Praxis ist es, die Mehrbelastung des barunterhaltspflichtigen Elternteils wegen Mitbetreuung über Herabstufung in der Einkommensgruppe der Düsseldorfer Tabelle zu erreichen. Diesen Weg geht der BGH in seiner Entscheidung aus dem Jahr 2014 (BGH, Beschluss vom 12.03.2014 – XII ZB 234/13, Rn 27ff.).
Kernaussagen des BGH:
- Der Bedarf des Kindes an Barunterhalt wird allein nach dem Einkommens des Elternteils festgestellt, der weniger als die Hälfte Naturalunterhalt leistet (also mit Hilfe der Düsseldorfer Tabelle nach der Standard-Methode ).
- Bei deutlich erweitertem Umgang mit dem Kind kann es zur Umgruppierung innerhalb der Einkommensgruppen der Düsseldorfer Tabelle kommen. Der BGH stellt es in den Ermessensspielraum des Tatrichters eine Entlastung des allein barunterhaltspflichtigen Elternteils dadurch herbeizuführen, in dem der Regelbedarf des Kindes durch Herabstufung der maßgeblichen Einkommensgruppe abgesengt wird.
Dies gilt vorallem dann, wenn die im Rahmen des weit ausgedehnten Umgangs entstandenen Kosten für die Kinderversorgung (z.B. für das Bereithalten von Wohnraum für das Kind) nicht als teilweise Erfüllung des Barunterhalts zur Anrechnung auf die Barunterhaltspflicht führt (BGH, Beschluss vom 12.03.2014 – XII ZB 234/13, Rn 37ff.). - Erbringt der Barunterhaltspflichtige aber teilweise (Natural-)Leistungen, die den Bedarf des Kindes an Barunterhalt decken, so kommen diese Leistungen zur Anrechnung auf den Barunterhalt. Dazu weiter
Haußleitner kommentiert die Entscheidung mit folgenden Schlussfolgerungen (siehe NJW-Spezial 2014, 516ff, Zitat): “Der BGH unterscheidet bei den Kosten, die Barunterhaltspflichtigen, die durch das Umgangsrecht entstehen, nach solchen Aufwendungen, die reiner Mehraufwand sind ohne den hauptsächlich Betreuenden zu entlasten und nach (teilweise) bedarfsdeckenden Aufwendungen, die neben dem Barunterhalt erbracht werden; nur letztere sind gekennzeichnet durch eine Entlastung des Berechtigten.
Zur ersten Gruppe gehören insbesondere die Unterbringungs- und Fahrtkosten. Zur zweiten Gruppe gehören dagegen alle Aufwendungen, die sonst der Barunterhaltsberechtigte aus dem Barunterhalt tätigen muss, wie etwa die Verpflegung, Kleidung und Schulutensilien etc. Der BGH gibt mit der Entscheidung den Tatrichtern auf,
in einem ersten Schritt
das tatsächliche Umgangsrecht zu analysieren. Nur wenn dieses ein „übliches Maß” überschreitet, können bei der Unterhaltsermittlung relevante Aufwendungen entstehen. Als übliches Maß versteht man den 14-tägigen Wochenendumgang mit zwei bis drei Übernachtungen. Wird dieses Maß nicht überschritten, ist eine Anpassung des Barunterhalts innerhalb der Tabellensätze der Düsseldorfer Tabelle etwa durch Herabstufung in der Düsseldorfer Tabelle oder Unterlassen einer Höherstufung nicht geboten.
[Zweiter Schritt]
Wird ein Kind vom Barunterhaltspflichtigen dagegen mehr als betreut, sind zunächst die Mehraufwendungen aus dem Bereich des Umgangsrechts für Fahrtkosten und Unterbringung zu analysieren. Da es bei diesen Aufwendungen um eine angemessene Herabstufung in der Düsseldorfer Tabelle geht, bietet es sich an zu prüfen, in welche Stufe der Barunterhaltspflichtige einzugruppieren wäre, wenn die Mehraufwendungen Abzugsposten bei der Ermittlung des Einkommens wären.
Zwar ist ausdrücklich ein Abzug dieser Aufwendungen bei der Ermittlung des Einsatzbetrags unzulässig. Andererseits kann aber die Untergrenze damit gebildet werden, denn wenn sich nicht einmal dann eine Herabstufung ergibt, wenn die Aufwendungen als Kosten des Pflichtigen betrachtet werden, gilt dies erst recht für die Angemessenheitsprüfung.
Im dritten Schritt
ist zu untersuchen, ob der Umgangsberechtigte über die Fahrt- und Unterbringungskosten hinaus Leistungen erbringt, mit denen er den Unterhaltsberechtigten entlastet. Eine weitergehende Minderung des Zahlbetrags kommt dann in Frage. Der BGH wirft ergänzend die Frage auf, mit welcher Vorhersehbarkeit eine Entlastung stattfindet. Bei hoher Verlässlichkeit des Umgangsberechtigten kann eine Reduktion eher in Frage kommen.
Wenn, wie im zu entscheidenden Fall, der im Schichtdienst arbeitende Polizeibeamte wenig Planungssicherheit für den Unterhaltsberechtigten gibt, spielt auch dies eine Rolle. Die im Einzelfall sich ergebende angemessene Minderung des Barunterhalts ist ohnehin Sache des tatrichterlichen Ermessens. Es bleibt insgesamt dabei, dass nur beim echten Wechselmodell und annähernd hälftiger Mitbetreuung eine Feststellung und Aufteilung des Barbedarfs des Kindes auf beide Eltern stattfinden soll.”
Wohn- und Fahrtkosten:
Der BGH schreibt die Rechtsprechung fest, wonach die Kosten für Wohnen und Transport, die demUmgangsberechtigten durch das Umgangsrecht entstehen, nicht abzugsfähig sind bei der Ermittlung des Einsatzbetrags. Diese Aufwendungen mindern den Bedarf des Kindes nicht, denn in den Tabellensätzen sind nur die bei einem Elternteil anfallenden Wohnkosten enthalten (Fortschreibung der Entscheidung des Senats vom 21. 12. 2005, NJW 2006, 2258).
Das Bereithalten von Wohnraum zur Übernachtung von Kindern bei einem im üblichen Rahmen ausgeübten Umgangsrecht sei in der Regel schon deshalb unbeachtlich, „weil es typischerweise angemessen und ausreichend ist, die Kinder in den Räumlichkeiten mit unterzubringen, die dem individuellen Wohnraumbedarf des Unterhaltspflichtigen entsprechen”. Vereinfacht ausgedrückt verweist der BGH die Kinder beim „üblichen” Umgangsberechtigten auf das Schlafsofa im Wohnzimmer. Gemäß § 1684 I BGH hat das minderjährige Kind Recht auf Umgang mit jedem Elternteil. Jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt.
Ein „übliches” Umgangsrecht an zwei Nächten von 14, wird diesen Vorgaben wenig gerecht. Der Umgangsberechtigte ist vielmehr gehalten, an der Betreuung und Erziehung seines Kindes mitzuwirken. Wenn er aber an der Betreuung und Erziehung mitwirkt und an mehr als zwei bis drei Nächten von 14 betreut, heißt das auch, dass er eine Unterhaltsleistung erbringt. Denn § 1606 III BGB stellt in Satz 2 fest, dass der Elternteil, der ein minderjähriges unverheiratetes Kind betreut, seine Verpflichtung zum Unterhalt des Kindes beizutragen in der Regel durch die Pflege und Erziehung des Kindes erfüllt.
Wenn er dies in der Regel tut, so heißt dies, dass eine Entlastung des Barunterhaltspflichtigen stattzufinden hat, wenn auch er wie der Unterhaltsberechtigte, durch Pflege und Erziehung zum Unterhalt des Kindes beiträgt und nicht nur, wenn er damit den Berechtigten entlastet. Eine echte Mitbetreuung und Miterziehung, bei der der Barunterhaltspflichtige beispielsweise an fünf von 14 Nächten betreut, erfordert daher eine Berücksichtigung der Wohn- und Fahrtkosten bei beiden Eltern, denn ein Schlafsofa im Wohnzimmer entspricht nicht der Realität bei einem ausgeweiteten Umgang und wird diesem Betreuungsumfang auch nicht gerecht.
Nimmt man den gesetzgeberischen Auftrag aus dem Bereich der gemeinsamen Sorge trotz Trennung ernst, muss bei getrennt lebenden Eltern die gemeinsam betreuen und erziehen, auch wenn dies nicht im Rahmen des echten Wechselmodells erfolgt, der Wohnbedarf des Kindes beim Unterhaltspflichtigen berücksichtigt werden, denn es hat eine Lebensmittelpunkt-Residenz und eine Umgangs-Residenz.”

BGH, Urteil vom 21.12.2005 – XII ZR 126/03
Zur teilweisen Naturalunterhaltsleistung des barunterhaltspflichtigen Elternteils
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat) “Allerdings kann auch der auf diesem Weg bestimmte Bedarf eines unterhaltsberechtigten Kindes gemindert sein, wenn er zu einem Teil anderweitig gedeckt wird. Dies führt im Grundsatz zu einer entsprechenden Verringerung seines Unterhaltsanspruchs (§ 1602 Abs. 1 BGB).
Art der Unterhaltsleistung bestimmen
(Zitat) Wird mithin das Unterhaltsbedürfnis des Kindes, etwa durch Gewährung von Bekleidung und Verpflegung, unentgeltlich erfüllt, so kann das die Höhe des Barunterhaltsanspruchs verringern. Diese Folge kann auch dann eintreten, wenn es der barunterhaltspflichtige Elternteil selbst ist, der den Unterhalt des minderjährigen Kindes zu einem Teil in anderer Weise als durch die Zahlung einer Geldrente nach § 1612 Abs. 1 Satz 1 BGB befriedigt (vgl. Senatsbeschluss vom 1. Februar 1984 – IVb ZB 49/83 – FamRZ 1984, 470, 472).
Mehr Umgangszteit als beim Residenzmodell?
(Zitat) Von einer – unterhaltsrechtlich erheblichen – teilweisen Bedarfsdeckung durch die Verpflegung des Klägers seitens des Beklagten kann ebenso wenig ausgegangen werden. Da die im Rahmen üblicher Umgangskontakte von etwa fünf bis sechs Tagen monatlich gewährte Verpflegung nicht zu Erstattungsansprüchen des besuchten Elternteils führt, sondern dieser die üblichen Kosten, die ihm bei der Ausübung des Umgangsrechts entstehen, grundsätzlich selbst zu tragen hat (vgl. Senatsurteil vom 23. Februar 2005 – XII ZR 56/02 – FamRZ 2005, 706, 707 f. m.w.N.), führt die Verpflegung während weiterer vier bis fünf Tage nicht zu nennenswerten Ersparnissen des anderen Elternteils. Sonstige den Bedarf des Klägers teilweise deckende konkrete Aufwendungen des Beklagten hat dieser nicht vorgetragen.“

BGH, Urteil vom 28.02.2007 – XII ZR 161/04
Zur teilweisen Naturalunterhaltsleistung des barunterhaltspflichtigen Elternteils
Hier bestätigt der BGH die Grundsätze zur Unterhaltsberechnung, die er bereits mit seinem Urteil aus dem Jahr 2005 zum Ausdruck brachte. Hier lag der Fall zu Grunde, dass die Mutter von zwei minderjährigen Zwillingen zu 70% teilzeitbeschäftigt war und zu 64% die Kinder ihre Zeit bei der Mutter verbrachten. Der Vater betreute zu 36% die Kinder und war halbtags tätig. Hier geht der BGH von einem unechten Wechselmodell aus. Die Barunterhaltspflicht bestimmt sich allein nach dem unterhaltsrelevanten Einkommen des Vaters. Der BGH weiter
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat): “Der vorgenannte Bedarf kann zwar gemindert sein, wenn er zu einem Teil anderweitig gedeckt wird. Dies führt im Grundsatz zu einer entsprechenden Verringerung des Unterhaltsanspruchs (§ 1602 Abs. 1 BGB), etwa wenn das Unterhaltsbedürfnis eines Kindes durch Gewährung von Bekleidung und Verpflegung erfüllt wird. Diese Folge kann auch dann eintreten, wenn es der barunterhaltspflichtige Elternteil selbst ist, der den Unterhalt des minderjährigen Kindes zu einem Teil in anderer Weise als durch die Zahlung einer Geldrente befriedigt (Senatsurteil vom 21. Dezember 2005 – XII ZR 126/03 – FamRZ 2006, 1015, 1017)“.
Weitere Rechtsprechung der Oberlandesgerichte zum Barunterhalt für das Kind bei Mitbetreuung

OLG München, Beschluss v. 03.05.2023 – 2 UF 1057/22 e
Umgangskosten übersteigender und z.T. bedarfsdeckender Mitbetreuungsaufwand?
Leitsatz:
Dem Umstand, dass mit einem weit über das übliche Maß hinausgehenden Umgangsrecht eines Elternteils eine finanzielle Mehrbelastung verbunden sein kann, kann grds. dadurch Rechnung getragen werden, dass etwaige Mehraufwendungen des barunterhaltspflichtigen Elternteils berücksichtigt werden können. (Rn. 19 – 20) (redaktioneller Leitsatz)
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat, Rn 20) “Grundsätzlich kann dem Umstand, dass mit einem weit über das übliche Maß hinausgehenden Umgangsrecht eines Elternteils eine finanzielle Mehrbelastung verbunden sein kann, dadurch Rechnung getragen werden, dass etwaige Mehraufwendungen des barunterhaltspflichtigen Elternteils berücksichtigt werden können.
Dabei ist jedoch im Ausgangspunkt zu unterscheiden zwischen den Kosten, die zu einer teilweisen Bedarfsdeckung auf Seiten des Kindes führen, und solchen Kosten, die reinen Mehraufwand für die Ausübung des erweiterten Umgangsrechts darstellen und den anderen Elternteil nicht entlasten. Sofern keine teilweise Bedarfsdeckung eintritt, kann den erhöhten wirtschaftlichen Belastungen des Unterhaltspflichtigen durch eine Herabstufung um eine oder sogar mehrere Einkommensgruppen der Düsseldorfer Tabelle Rechnung getragen werden (BGH NJW 2014, 1958; OLG Düsseldorf JAmt 2016, 169 = BeckRS 2016, 1216; vgl. OLG Brandenburg, Beschluss vom 14.4.2022 – 9 UF 155/21, NZFam 2022, 975, beck-online).
- Weiterführende Links:
» Zur eingeschränkten Einkommensbereinigung bei Zahlung des Mindestunterhalts

OLG Koblenz, Beschluss v. 27.5.2021 − 7 UF 689/20
Mehraufwand für das Kind bei ausgedehntem Umgangsrecht
Orientierungssatz:
Nimmt der barunterhaltspflichtige Elternteil ein weit über das übliche Maß hinausgehendes Umgangsrecht wahr, können erhöhten Aufwendungen, die als reiner Mehraufwand dem Kind nicht als bedarfsdeckend entgegengehalten werden können, zu einer Herabstufung um eine oder mehrere Einkommensgruppen der Düsseldorfer Tabelle führen.
Der Unterhaltsbedarf des Kindes kann weitergehend gemindert sein, wenn der barunterhaltspflichtige Elternteil dem Kind im Zuge seines erweiterten Umgangsrechts Leistungen erbringt, mit denen er den Unterhaltsbedarf des Kindes auf andere Weise als durch Zahlung einer Geldrente teilweise deckt. Hingegen kommt ein Abzug dieser Kosten vom Einkommen des barunterhaltspflichtigen Elternteils grundsätzlich nicht in Betracht, wenn diesem auch nach dem Abzug dieser Kosten noch ein ausreichendes Einkommen verbleibt (vgl. BGH FamRZ 2014, 917 = NJW 2014, 1958).
Ist der barunterhaltspflichtige Elternteil hingegen allenfalls zur Zahlung des Mindestkindesunterhalts in der Lage, kann es indes sachgerecht sein, erheblich erweiterte Umgangskosten anteilig vom Einkommen des barunterhaltspflichtigen Elternteils abzusetzen.

KG, Beschluss vom 15.4.2019 – 13 UF 89/16
Kosten des erweiterten Umgangs – Herabstufung der Einkommensgruppe der DT
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat) “Mit dem erweiterten Umgang verbundene Kosten könne der [zu 45% betreuende Elternteil] nicht geltend machen. Bei derartigen Kosten sei danach zu differenzieren, ob sie zu einer teilweisen Deckung des kindlichen Bedarfs führen oder den reinen Mehraufwand für die Ausübung des erweiterten Umgangs bilden und den anderen Elternteil nicht entlasten (vgl. BGH FamRZ NZFam 2014, 600).
Der Mehraufwand infolge des erweiterten Umgangs werde pauschal durch den Verzicht auf eine ansonsten gebotene Heraufstufung in der Gruppeneinteilung der DT bzw. eine Herabstufung bis hinab zum Mindestunterhal t, berücksichtigt. Bei anderen, aus dem Unterhalt zu tragenden Kosten sei wegen § § 1612 Absatz I 1 BGB nur dann zur Erbringung von Sach- bzw. Naturalleistungen berechtigt, wenn er zuvor das Einvernehmen mit dem anderen Elternteil erzielt habe (vgl. Wendl/Dose § 2 Rn. 21).“
Anmerkung: Das KG beschäftigt sich mit der Frage, ob der vom pflichtigen Elternteil geschuldete Barunterhalt zu mindern ist, weil der betreffende Elternteil für das unterhaltsberechtigte Kind regelmäßig Bekleidung kauft, Reisen finanziert oder sonstige Ausgaben bestreitet.
FAQ: Mitbetreuung und Kindesunterhalt
Was ist das Wechselmodell bei der Kinderbetreuung?
Das Wechselmodell beschreibt eine Kinderbetreuung im Verhältnis von 50/50. Es hat eine spezielle Methode zur Unterhaltsberechnung, die nicht auf andere Betreuungsmodelle übertragbar ist.
Wie wird der Kindesunterhalt bei Mitbetreuung berechnet?
Wenn der Betreuungsanteil eines Elternteils über das Residenzmodell hinausgeht (mehr als 29 %, aber weniger als 50 %), werden die zusätzlichen Betreuungsleistungen unter Berücksichtigung der Düsseldorfer Tabelle bei der Unterhaltsberechnung einbezogen.
Welche Kosten fallen beim barunterhaltspflichtigen Elternteil an?
Zu den Kosten zählen Unterkunft, Verpflegung, Freizeitaktivitäten und Fahrtkosten, die im Rahmen des Umgangs oder der Mitbetreuung entstehen. Diese können unter Umständen den Unterhaltsbetrag reduzieren.
Können Umgangskosten die Barunterhaltspflicht mindern?
Ja, in Ausnahmefällen, insbesondere wenn die Umgangskosten außergewöhnlich hoch sind und den Selbstbehalt des unterhaltspflichtigen Elternteils gefährden.
Was ist der Unterschied zwischen Betreuungskosten und Umgangskosten?
Betreuungskosten entstehen beim hauptsächlich betreuenden Elternteil. Umgangskosten fallen beim barunterhaltspflichtigen Elternteil an und umfassen Ausgaben für Besuche, Übernachtungen und Verpflegung.
Wie wird mit ausgedehnten Umgangszeiten umgegangen?
Wenn die Umgangszeiten des barunterhaltspflichtigen Elternteils über das übliche Maß hinausgehen (über 29 %), können diese Zeiten den Unterhaltspflichten durch eine Herabstufung der Einkommensgruppe in der Düsseldorfer Tabelle Rechnung tragen.
Was gilt bei hohen Fahrtkosten?
Bei überdurchschnittlich hohen Fahrtkosten kann der Unterhaltspflichtige eine Einkommensbereinigung beantragen. Diese wird jedoch nur in Ausnahmefällen genehmigt, wenn der Selbstbehalt sonst nicht ausreicht.
Welche rechtlichen Schritte können Väter zur Mitbetreuung einleiten?
Väter können gerichtlich auf eine paritätische Betreuung hinwirken, auch wenn dies nicht explizit gesetzlich geregelt ist. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts haben die Rechte von Vätern in den letzten Jahren gestärkt.

Diese FAQ bieten eine Grundlage für die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema Mitbetreuung und Kindesunterhalt.
Für spezifische Fälle empfiehlt es sich, rechtliche Beratung einzuholen.
Links & Literatur
Links
- Leitfaden für Eltern
- Kinderbetreuung im Wechselmodell
- Wegweiser für den Umgang nach Trennung und Scheidung
Literatur
- Gerhard Christl, Kindes(mit)betreuung trotz Trennung – unterhalts- und sozialrechtliche Fragen, in: NZFam 2023, 193
- Ernst Spangenberg, Umgangskosten, in: NZFam 2016, 241
- Thomas A. Heiß, Ansprüche aus dem Eltern-Kind-Verhältnis und aus dem Umgangsrecht, in: FPR 2011, 96
