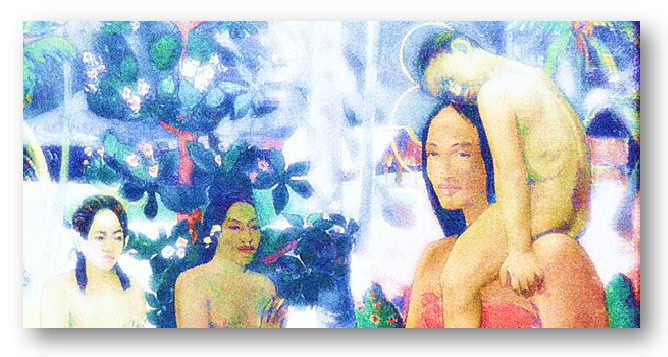- Dein Warenkorb ist leer.
Unterhalt wegen Kinderbetreuung
Kind stammt nicht aus Ehe der Eltern – § 1615l BGB
Standort:
Scheidung > Kanzlei > Infothek > Unterhalt > Betreuungsunterhalt nach § 1615l BGB
Unterhalt wegen Kinderbetreuung für alleinerziehende Eltern
Eine Geburt ist ein freudiges Ereignis, bringt jedoch auch viele rechtliche und finanzielle Fragen mit sich – insbesondere wenn es um den Unterhalt für das neugeborene Kind geht. Wer muss zahlen? Wie hoch ist der Anspruch? Und was passiert, wenn der Unterhaltspflichtige nicht zahlen kann oder will?
Mit diesem Artikel finden Sie umfassende Informationen rund um das Thema Kindesunterhalt ab Geburt, Ihre Rechte und Pflichten sowie hilfreiche Tipps zur Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.
Das Wichtigste in Kürze
- Die traditionelle Ehe verliert an Attraktivität. Gleichzeitig nimmt die Anzahl der Mütter ohne Ehepartner zu. Frauen, die sich am Anfang oder in der Mitte ihrer beruflichen Laufbahn befinden, erfahren durch eine Schwangerschaft und anschließende Kinderbetreuung einen erheblichen Karriereknick und Einbußen in ihrer wirtschaftlichen Position.
- Dabei haben nichteheliche Lebenspartner grundsätzlich keine Unterhaltspflicht füreinander. Anders als geschiedene Ehegatten haben unverheiratete Partner nach dem Ende ihrer Partnerschaft keine Ansprüche auf Unterhalt aufgrund von Krankheit, Alter, Erwerbslosigkeit oder Ausbildung.
- Nur wenn aus der nichtehelichen Beziehung ein Kind hervorgeht, besteht ein Anspruch auf Unterhalt gemäß § 1615l BGB. Dieser Anspruch auf Betreuungsunterhalt nach § 1615l BGB gewinnt für die Praxis zunehmend an Bedeutung. Es stellt sich die Frage, ob der Vater des Kindes für den Karriereknick der Mutter finanziell haftet? In welchem Ausmaß muss der leibliche Vater mit seinem Einkommen zur Kompensation des Karriereknicks der Mutter beitragen?
Beispiel aus der Praxis
| Sachverhalt – Rechtliche Würdigung
Ein Beispiel zum Kinderbetreuungsunterhalt aus unserer Praxis. Jetzt lesen!

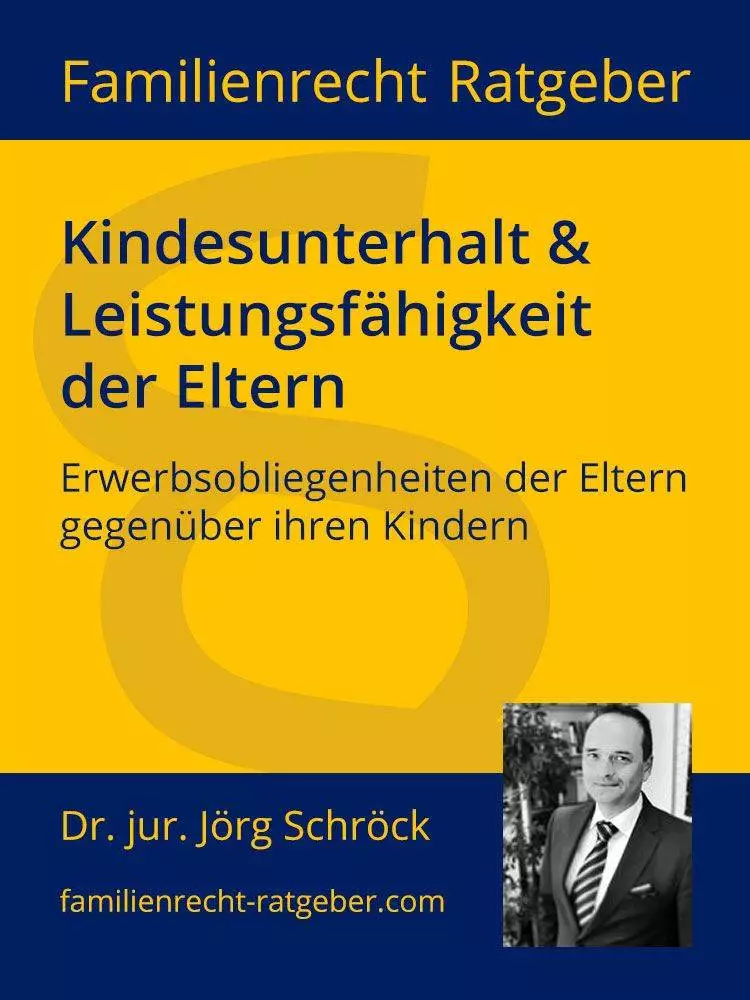
Unterhalt für kinderbetreuende Eltern
Buch zum Thema (Kindle-Edition)
Inhaltsverzeichnis | Wegweiser zum Betreuungsunterhalt nach § 1615l BGB
Familienrecht der nichtehelichen Lebensgemeinschaft
Unterschiede im rechtlichen Schutz zur Ehe
| Partnerschaftsvertrag
Eine Alternative zur Ehe. Jetzt lesen!
Die rechtliche Situation zwischen verheirateten und unverheirateten Partnern unterscheidet sich erheblich. Im Falle einer Trennung haben unverheiratete Partner keinen Anspruch auf Zugewinnausgleich oder Versorgungsausgleich. Im Todesfall gibt es kein gesetzliches Erbrecht und keine bevorzugte Erbschaftssteuer für unverheiratete Partner. Zudem besteht kein Anspruch auf Witwenrente. Wer sich hier für den Trennungsfall besser schützen will, ist auf vertragliche Regelungen angewiesen.
Unterhaltsrecht der nichtehelichen Lebensgemeinschaft

BGH, Urteil v.16.07.2008 – XII ZR 109/05
Zum Betreuungsunterhalt nicht miteinander verheirateter Eltern
Anmerkung: Der BGH stellt hier die Grundsätze zum Betreuungsunterhalt sehr gut dar (vgl. Pressemitteilung 139/08).
Durch das Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz (vom 21. August 1995, BGBl. I S. 1050) hatte der Gesetzgeber den Unterhaltsanspruch wegen Betreuung eines nichtehelich geborenen Kindes für die Zeit ab dem 1. Januar 1996 auf die Dauer von drei Jahren ab der Geburt des Kindes erweitert. Zugleich hatte er den Unterhaltsanspruch auch inhaltlich erweitert und der Mutter das Recht eingeräumt, frei zu entscheiden, ob sie das Kind in den ersten drei Lebensjahren selbst erziehen oder eine anderweitige Betreuungsmöglichkeit in Anspruch nehmen wollte.
Erst durch das Kindschaftsrechtsreformgesetz (vom 16. Dezember 1997, BGBl. I S. 2942) hatte der Gesetzgeber die starre Befristung des Unterhaltsanspruchs bei Betreuung eines nichtehelich geborenen Kindes aufgegeben und zum 1. Juli 1998 eine Billigkeitsregelung eingeführt, die es ermöglichte, den Unterhaltsanspruch über die Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes hinaus zu verlängern, sofern es „insbesondere unter Berücksichtigung der Belange des Kindes grob unbillig wäre, einen Unterhaltsanspruch nach Ablauf dieser Frist zu versagen“.
Mit Beschluss vom 28. Februar 2007 hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 118, 45 = FamRZ 2007, 965) die damals noch unterschiedliche Ausgestaltung des nachehelichen Betreuungsunterhalts in § 1570 BGB einerseits und des Unterhalts wegen Betreuung eines nichtehelich geborenen Kindes in § 1615 l Abs. 2 BGB andererseits wegen Verstoßes gegen Art. 6 Abs. 5 GG für verfassungswidrig erklärt. Nach dem Willen des Gesetzgebers seien im Rahmen der Billigkeitsentscheidung für eine Verlängerung des Betreuungsunterhalts allein kindbezogene Gründe zu berücksichtigen und diese dürften im Hinblick auf Art. 6 Abs. 5 GG für ehelich und nichtehelich geborene Kinder nicht unterschiedlich gewertet werden.
Auf der Grundlage dieser verfassungsrechtlichen Vorgaben hat der Gesetzgeber den Betreuungsunterhalt durch das zum 1. Januar 2008 in Kraft getretene Unterhaltsrechtsänderungsgesetz neu geregelt. Dabei hat er zwar beide gesetzliche Vorschriften über den Betreuungsunterhalt geändert, sich aber am System des Betreuungsunterhalts in § 1615 l BGB a. F. orientiert, wonach dem betreuenden Elternteil ein Basisunterhalt für die Dauer von drei Jahren mit Verlängerungsmöglichkeit zusteht.
Zusammenfassung: Im Bereich des Kindesunterhalts und des Betreuungsunterhalts werden nichteheliche und ehelichen Lebensgemeinschaften weitgehend gleich behandelt. Dennoch sind erhebliche Unterschiede bei der Unterhaltsermittlung festzustellen. Das beginnt bereits bei der
- Im Rahmen des Betreuungsunterhalts nach § 1615 l Abs. 2 BGB ist Bedarfsmaßstab die eigene Lebensstellung des kinderbetreuenden Elternteils (§ 1610 Abs. 1 BGB). Das folgt aus dem Verweis des § 1615l Abs.3 S.1 auf die Vorschriften zum Verwandtenunterhalt (§§ 1601 ff BGB).
- Beim Kinderbetreuungsunterhalt nach § 1570 BGB (eheliches Kind) ermittelt sich der Rechtsanspruch nach den gemeinsamen Lebensverhältnissen der Ehegatten. Auch für die Zeit des Zusammenlebens in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft ist dieser Bedarfsmaßstab nicht auf § 1615l BGB übertragbar (BGH, Urteil vom 16. Juli 2008 – XII ZR 109/05, Rn 33).
Exkurs: Vermögensrechte bei Scheitern der Lebensgemeinschaft
Die nichteheliche Lebensgemeinschaft ist im Familienrecht nicht gesetzlich geregelt. Das Recht der nichtehelichen Lebensgemeinschaft („eheähnliche Gemeinschaft“) wird durch Richterrecht geprägt. Dabei werden Regeln des Familienrechts (insbesondere Schutzrechte für den wirtschaftlich schwächeren Lebenspartner) nur sehr zurückhaltend auf die nichteheliche Lebensgemeinschaft analog angewendet.
Grundsätzlich werden Ausgleichsrechte bei Scheitern der nichtehelichen Lebensgemeinschaft nicht anerkannt, sofern die Partner der Lebensgemeinschaft dies nicht ausdrücklich vereinbart haben oder gesetzliche Ausgleichsmechanismen des allgemeinen Zivilrechts einen Ausgleichsanspruch begründen können. Die Rechtsprechung hat aber in einigen Urteilen familienrechtliche Rechtswirkungen für eine eheähnliche Gemeinschaft anerkannt. Besonders hervorzuheben ist hier BGH, Urteil vom 09.07.2008 – XII ZR 179/05.
- Weiterführende Links:
» Vermögensauseinandersetzung der nichtehelichen Lebensgemeinschaft
Prüfungsschema zu § 1615l BGB
Anspruchsgrundlage § 1615l BGB | Gesetzestext
(1) Der Vater hat der Mutter für die Dauer von sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt des Kindes Unterhalt zu gewähren. Dies gilt auch hinsichtlich der Kosten, die infolge der Schwangerschaft oder der Entbindung außerhalb dieses Zeitraums entstehen.
(2) Soweit die Mutter einer Erwerbstätigkeit nicht nachgeht, weil sie infolge der Schwangerschaft oder einer durch die Schwangerschaft oder die Entbindung verursachten Krankheit dazu außerstande ist, ist der Vater verpflichtet, ihr über die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Zeit hinaus Unterhalt zu gewähren.
Das Gleiche gilt, soweit von der Mutter wegen der Pflege oder Erziehung des Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann. Die Unterhaltspflicht beginnt frühestens vier Monate vor der Geburt und besteht für mindestens drei Jahre nach der Geburt. Sie verlängert sich, solange und soweit dies der Billigkeit entspricht. Dabei sind insbesondere die Belange des Kindes und die bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu berücksichtigen.
(3) Die Vorschriften über die Unterhaltspflicht zwischen Verwandten sind entsprechend anzuwenden. Die Verpflichtung des Vaters geht der Verpflichtung der Verwandten der Mutter vor. § 1613 Abs. 2 gilt entsprechend. Der Anspruch erlischt nicht mit dem Tode des Vaters.
(4) Wenn der Vater das Kind betreut, steht ihm der Anspruch nach Absatz 2 Satz 2 gegen die Mutter zu. In diesem Falle gilt Absatz 3 entsprechend.
Vaterschaft muss feststehen

OLG Oldenburg, Beschluss vom 27.06.2018 – 11 WF 110/18
Zur rechtlichen Vaterschaft
Leitsatz:
Die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen der Mutter nach § 1615l BGB setzt das Bestehen der rechtlichen Vaterschaft aufgrund Anerkennung oder rechtskräftiger Feststellung voraus.
- Weiterführende Links:
» Leitfaden für Väter
Bedarf des kinderbetreuenden Elternteils
Bedarfsmaßstäbe
» 1. Maßstab:
Schwangerschafts- und Entbindungskosten
» 2. Maßstab:
Karriereknick – Einkommen vor der Schwangerschaft
» 3. Maßstab:
Halbteilungsgrundsatz
» 4. Maßstab:
Mindestbedarf
» 5. Maßstab:
Konkreter Bedarf?
1. Bedarfsmaßstab: Schwangerschafts- und Entbindungskosten
Der Anspruch auf Kostenerstattung ist Teil des Unterhaltsanspruchs nach § 1615l Abs.1 S.1 BGB. Der Vater muss der Mutter auch Kosten erstatten, die außerhalb des in § 1615l Abs.1 S.1 BGB genannten Zeitraums entstehen. Voraussetzung ist eine Kausalität zwischen Schwangerschaft, Entbindung und den Kosten.
Der Kostenaufwand lässt sich als Sonderbedarf der Mutter qualifizieren und umfasst Aufwendungen für Arzt, Klinikaufenthalt, Hebamme, Medikamente etc., aber auch alle Schwangerschaftsfolge- und Entbindungsfolgekosten (ärztliche Vor- und Nachuntersuchungen, Schwangerschaftsgymnastik. Ersetzt werden nur die tatsächlichen Kosten, wobei der Anspruch sich um Zahlungen der Sozialversicherungsträger oder Privatversicherungen ermäßigt. Der Kostenerstattungsanspruch ist seiner Art nach ein Unterhaltsanspruch und damit abhängig von Bedürftigkeit und Leistungsfähigkeit.
Erste Babyausstattung: Die Erstausstattung eines Säuglings stellt Sonderbedarf des Kindes i.S. des § 1613 Abs.2 Ziff. 1 BGB dar und kann im Wege einer Schätzung mit einem Pauschalbetrag von 1.000,00 € gefordert werden (vgl. OLG Koblenz, Urteil vom 12.05.2009 – 11 UF 24/09; NJW-RR 2009, 1305).
2. Bedarfsmaßstab: Karriereknick wegen Schwangerschaft bzw. Kinderbetreuung
(§ 1615l Abs.3 S.1 i.V.m. § 1610 BGB)

OLG Oldenburg, Hinweisbeschluss vom 05.05.2023 – 13 UF 88/19 (intern vorhanden, Az.: 101/19)
Zweck des Unterhalts nach § 1615 l BGB – Bedarf nach ehemaligem Einkommen vor Schwangerschaft bzw. Kindererziehung
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat) “Zur Ermittlung des Unterhaltsbedarfs der Antragstellerin ist auf das von ihr zuletzt erzielte Einkommen aus einer Vollzeittätigkeit abzustellen. Denn Zweck des Unterhalts nach § 1615 l BGB ist, Einkommensausfälle der nichtehelichen Mutter aufgrund von Schwangerschaft, Geburt und Erziehung des Kindes zumindest in dessen ersten drei Lebensjahren zu kompensieren. Anknüpfungspunkt für deren Bedarf ist folglich ihr früheres Einkommen (vgl. nur BGH FamRZ 2005, 442-445, juris Rdnr. 10).
Aufgrund dieser Anknüpfung kann daher auch nur das Erwerbseinkommen der Mutter für deren Bedarf maßgeblich sein, nicht sonstige Einkünfte wie Zinserträge o.ä., die unabhängig von Schwangerschaft, Geburt und Kindesbetreuung erzielt werden können. Die Anknüpfung an das frühere Einkommen bewirkt auch, dass Leistungen wie das Mutterschaftsgeld, das von den gesetzlichen Krankenkassen während der Schutzfristen vor und nach der Entbindung sowie für den Entbindungstag gezahlt wird, nicht bedarfsprägend sein können.”
Anmerkung:
Mit der Bedarfsermittlung wird die grundsätzliche Höhe eines Unterhalts bestimmt. Der Bedarf an Betreuungsunterhalt nach § 1615l BGB richtet sich ausschließlich nach der eigenen Lebensstellung des kinderbetreuenden Elternteils. Das ergibt sich aus dem Verweis des § 1615l Abs.3 S.1 BGB auf § 1610 BGB. Damit ist Bedarfsmaßstab das Einkommen des kinderbetreuenden Elternteils, das vor Geburt des Kindes erzielt wurde. Das Einkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils wird nur zur möglichen Korrektur des Bedarfs nach dem Halbteilungsgrundsatz berücksichtigt.

BGH, Beschluss vom 10.6.2015 – XII ZB 251/14
Bedarf = gegenwärtiger und künftiger Einkommensverlust wegen Kinderbetreuung
Leitsatz:
“Die Lebensstellung des nach den § 1615 L Absatz II, § 1610 Absatz I BGB Unterhaltsberechtigten richtet sich danach, welche Einkünfte er ohne die Geburt und die Betreuung des gemeinsamen Kindes hätte. Sie ist deshalb nicht auf den Zeitpunkt der Geburt des Kindes festgeschrieben, sodass sich später ein höherer Bedarf ergeben kann.”
Anmerkung:
Die Ermittlung des Bedarfs nach Betreuungsunterhalt knopft am real erzielten Einkommen bis zur Zeit der Geburt des Kindes an und orientiert sich dann über den fortlaufenden Zeitraum des Unterhaltsanspruchs an den fiktiven Erwerbsmöglichkeiten des Unterhaltsbedürftigen, die ohne Geburt des Kindes bestehen würden (BGH, Beschluss vom 10.6.2015 – XII ZB 251/14).
Kompensation des Karriereknicks:
Zur Bestimmung der Lebensstellung des kinderbetreuenden Unterhaltsberechtigten stellt der BGH hier auf die Feststellung des Karriereknicks (= gegenwärtiger und künftiger Einkommensverlust wegen Kinderbetreuung) ab. Wenn also der Unterhaltsgläubiger plausibel darstellen kann, dass er ohne Kinderbetreuung die “Karriereleiter höher gestiegen” wäre, dann es im Lauf der Kinderbetreuungszeit zur Bedarfssteigerung kommen. Der Karriereknick muss sich als “hoch wahrscheinlich” darstellen lassen.
Nachhaltig erwirtschaftetes Einkommen:
Das führt dazu, dass nur das nachhaltig erwirtschaftete, dauerhaft gesicherte Erwerbseinkommen den Bedarfsmaßstab abbildet, welches nun aufgrund der Kinderbetreuung wegfällt (KG Berlin, Beschluss vom 24.09.2018 – 13 UF 33/18). Das Kriterium des nachhaltig erwirtschafteten Einkommens fehlt z.B. dann, wenn die Erwerbsbiografie durch wechselnde Zeiten von Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit und/oder sonstigen Berufspausen gekennzeichnet ist.
In solch einem Fall lässt sich ein Karriereknick wegen Kinderbetreuung kaum plausibel darstellen. Hier kann es angemessen sein, wegen erheblichen Einkommensschwankungen (wegen Mangel an nachhaltig erzieltem Einkommen, Erwerbsbiografie gekennzeichnet durch kurze Zeiten der Erwerbstätigkeit, Zeiten der Arbeitslosigkeit, Inanspruchnahme von Sozialleistungen), das Durchschnittseinkommen aus mehreren Wirtschaftsjahren zu Grunde zu legen.
Karriereknick und Inflationsbereinigung:
Die fiktive Betrachtung der möglichen weiteren Einkommensentwicklung ohne Kinderbetreuung ist kein Einfallstor für eine inflationsbereinigte Bedarfsermittlung. Dafür müsste eine Wertsicherungsklausel ausdrücklich vereinbart werden. Die hypothetische Annahme von entgangenen Erwerbschancen ist ein Vortrag erforderlich, dass Kollegen beim gleichen Arbeitgeber Gehaltssteigerungen tatsächlich realisiert haben, die vom Kinderbetreuenden Elternteil tatsächlich nicht realisiert werden konnten.
Dieser Vortrag kann nicht mithilfe eines Verweises auf Wertsicherungsrechners zu Inflationsbereinigung ersetzt werden (AG Starnberg, Beschluss vom 23.05.2023 – 1 F 1040/21, intern vorhanden, unser Az.: 95/21).
Es gibt weder beim Ehegattenunterhalt noch beim Kinderbetreungsunterhalt eine gesetzlich vorgesehene inflationsbedingte Wertsicherung (Indexierung). Ein dynamischer Unterhaltstitel mit Wertsicherungseffekt ist nur beim Kindesunterhalt aufgrund der Düsseldorfer Tabelle gegeben. Wollte man hier den Verdienstausfall indexieren, müsste dies konsequenter Weise ebenfalls beim Einkommen des Unterhaltspflichtigen wegen des Halbteilungsgrundsatzes erfolgen.
Eine ungeklärte Rechtsfrage ist, ob tatsächlich gezahlte Inflationsausgleichsprämien des ehemaligen Arbeitgebers an die Kollegen den Bedarf an Betreuungsunterhalt mitbestimmen können. Eine entsprechende Rechtsprechung bleibt abzuwarten.

KG, Beschluss vom 25.09.2018 – 13 UF 33/18
Bedarf nach hyothetisch weiter entwickelter Lebensstellung ohne Kinderbetreuung
Sachverhalt:
Das nicht verheiratete Paar hatte sich schon vor der Geburt des Kindes getrennt. Die Frau entschied sich dafür, das Kind selbst zu betreuen und ihre Stelle aufzugeben. Vom Vater des Kindes verlangte sie Betreuungsunterhalt und ging dabei von einem Unterhaltsbedarf von 2.600 Euro monatlich aus. So viel hatte die Mutter vor der Geburt verdient — allerdings hatte sie nur eine Woche gearbeitet. Als sie nach Abschluss ihrer Hochschulausbildung die erste Stelle im erlernten Beruf angetreten hatte, war sie bereits schwanger. Wegen des Beschäftigungsverbots in den letzten Wochen der Schwangerschaft war die Frau bis zum Beginn der Elternzeit nur eine Woche berufstätig.
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat, Rn 16): “Entscheidend ist, welches Einkommen der betreuende Elternteil ohne Geburt oder Kinderbetreuung erwirtschaftet hätte; an diesen Betrag ist anzuknüpfen. Das gilt allerdings nur, soweit es sich hierbei um ein nachhaltig erzieltes, dauerhaft gesichertes Einkommen handelt.
Ein solches liegt nicht vor, wenn die Erwerbsbiographie durch wechselnde Zeiten der Berufstätigkeit und Arbeitslosigkeit gekennzeichnet ist (vgl. BGH, Urteil vom 16. Juli 2008 – XII ZR 109/05, BGHZ 177, 272 = FamRZ 2008, 1739 [bei juris Rz. 25]; BGH, Urteil vom 17. Januar 2007 – XII ZR 104/03, FamRZ 2007, 1303 [bei juris Rz. 17]; OLG Saarbrücken, Beschluss vom 11. Juli 2013 – 6 UF 24/13, FamRZ 2014, 484 [bei juris Rz. 35, 38] sowie Büte/Poppen/Menne-Menne, Unterhaltsrecht [3. Aufl. 2015], § 1615l, Rn. 29, 30).”
(Zitat, Rn 20): “[…] nach der neueren höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. BGH, Beschluss vom 10. Juni 2015 – XII ZB 251/14, BGHZ 205, 342 = FamRZ 2015, 1369 [bei juris Rz. 34]), der sich die Obergerichte inzwischen angeschlossen haben (vgl. etwa OLG Köln, Beschluss vom 21. Februar 2017 – 25 UF 149/16, FamRZ 2017, 1309 [bei juris Rz. 36ff.]), wird der Unterhaltsbedarf des nicht verheirateten, betreuenden Elternteils nicht mehr unabänderlich durch die Lebensstellung bestimmt, die er im Zeitpunkt der Geburt des Kindes hatte, sondern danach, welche Einkünfte er ohne die Geburt und die Betreuung des gemeinsamen Kindes hätte erzielen können.
Der Unterhaltsbedarf ist also nicht mehr auf den Zeitpunkt der Geburt des Kindes festgeschrieben, sondern im Zeitpunkt der zu treffenden Entscheidung ist vom Zeitpunkt der Geburt des Kindes ausgehend zu prüfen, wie sich die Lebensstellung des betreuenden Elternteils ohne die Geburt des Kindes hypothetisch weiter entwickelt hätte:
Maßstab für den Bedarf des betreuenden Elternteils ist damit sein im konkreten Einzelfall nach seinen individuellen Fähigkeiten erzielbares hypothetisches Erwerbseinkommen, dass er erzielen würde, wenn nicht das zu betreuende Kind geboren worden wäre, sondern er seine bisherige Berufstätigkeit bzw. Ausbildung/Studium planmäßig fortgeführt hätte (vgl. Ehinger/Rasch/Schwonberg/Siede-Schwonberg, Handbuch des Unterhaltsrechts [8. Aufl. 2018] Kap. 4 Rn. 4.51, 4.51a).”

OLG Oldenburg, Hinweisbeschluss vom 05.05.2023 – 13 UF 88/19
(intern vorhanden, Az.: 101/19)
Bereinigung des bedarfsprägenden Einkommens um berufsbedingte Aufwendungen
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat) “Die Anknüpfung an das ohne Schwangerschaft bzw. Kindererziehung erzielte Einkommen bewirkt weiter, dass hinsichtlich der berufsbedingten Aufwendungen der Antragstellerin an die seinerzeitigen Aufwendungen anzuknüpfen ist und nicht an die reduzierten Aufwendungen während des Beschäftigungsverbotes.
Die Anwendung einer Pauschale hinsichtlich der berufsbedingten Aufwendungen der Antragstellerin erscheint auch vor dem Hintergrund der bei Nutzung eines häuslichen Arbeitsplatzes anfallenden Kosten, insbesondere der Aufwendungen für anteilige Miete, sachgerecht.”
3. Bedarfsmaßstab: Bedarfsbegrenzung nach Halbteilungsgrundsatz
Situation: Kinderbetreuende Mutter erzielt mehr Einkommen als der Vater
Ein Problem taucht bei der Bedarfsermittlung nach der Lebensstellung des kinderbetreuenden Elternteils auf, wenn beispielsweise eine freiberufliche Ärztin mit einem monatlichen Einkommen von 6.000 € von einem Mann mit einem Einkommen von 2.000 € schwanger wird und nach Geburt des Kindes wegen Geburt des Kindes ein geringeres Einkommen (z.B. 3.000 €) bezieht. Angesprochen sind die Fälle, in denen der Bedarf der kinderbetreuenden Mutter höher ist, als die Hälfte des dem unterhaltspflichtigen Vater zur Verfügung stehende Einkommen.
Ist das eigene Einkommen des kinderbetreuenden Elternteils – auch nach Geburt des Kindes – immer noch höher als das Einkommen des nicht kinderbetreuenden Elternteils, könnte man auf die Idee kommen, dass der unterhaltspflichtige Elternteil keinen Betreuungsunterhalt schuldet. Denn würde man nun den Unterhaltsbedarf nach Quote und Differenz zwischen dem Einkommensniveau beider Eltern ermitteln (dritter Bedarfsmaßstab), kann sich ein Unterhaltsbedarf zu Gunsten des kinderbetreuenden Elternteils mit höheren Einkommen niemals ergeben.
Würde man dagegen bei der Bedarfsermittlung allein auf den Einkommensrückgang wegen Geburt des Kindes abstellen (zweiter Bedarfsmaßstab), so wäre der Bedarf des Unterhaltsberechtigten, der vor Geburt des Kindes in sehr guten wirtschaftlichen Verhältnissen lebte, entsprechend hoch.
Es käme oftmals zu dem Phänomen, dass die Höhe des zu leistenden Unterhalts höher wäre, als der dem Unterhaltspflichtigen zu belassenden Selbstbehalt. Je höher das Einkommen der kinderbetreuenden Mutter vor der Geburt des Kindes war, desto höher wird der Bedarf an Unterhalt wegen Geburt eines nichtehelichen Kindes ausfallen. Dies kann dazu führen, dass mehr Unterhalt beansprucht werden könnte, als wenn das Kind aus einer Ehe mit dem unterhaltspflichtigen Vater hervorgegangen wäre.
Das soll aber nicht sein. Denn es gilt der Grundsatz, dass nach Sinn und Zweck des Unterhaltsrechts der Verpflichtete wegen der Zahlung des Unterhalts nicht bedürftiger sein darf als der Berechtigte. Da nicht nur die unterhaltsberechtigte Mutter, sondern auch der unterhaltspflichtige Vater einen Anspruch auf angemessenen Unterhalt hat (§§ 1610 I, 1603 I BGB), ist nach der Rechtsprechung des BGH der Anspruch der Mutter in der Höhe durch den Grundsatz der Halbteilung als Ausprägung des im Unterhaltsrecht geltenden Gerechtigkeitsgedanken begrenzt, denn der Unterhaltsberechtigte soll sich nicht durch die Unterhaltsgewährung besser stehen als der Verpflichtete.
Bedarfsbegrenzung nach Halbteilungsgrundsatz

BGH, Urteil vom 15.05.2019 – XII ZB 357/18
Bedarfsbegrenzung nach Halbteilungsgrundsatz
Anmerkung:
Der Halbteilungsgrundsatz gilt auch beim beim Kinderbetreuungsunterhalt nach § 1615l BGB. In der Vergangenheit war unklar, ob dieser bei der Bedarfsermittlung oder erst bei der Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners zu berücksichtigen ist. Zwischenzeitlich ist klar, dass der Grundsatz der Halbteilung bereits den Unterhaltsbedarf begrenzen kann.
- Das Bundesverfassungsgericht hat die die Begrenzung des Betreuungsunterhaltsanspruchs aus § 1615l Abs.2 S.2 BGB nach Halbteilungsgrundsatz bereits auf der Bedarfsebene als verfassungsgemäß gebilligt hat (BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 13. Februar 2018 – 1 BvR 2759/16-juris).
- Der BGH hat sich zwischenzeitlich für die die Brenzung nach Halbteilung auf der Bedarfsebene entschieden (Bömelburg/Gutdeutsch, FamRZ 2020, 657).
Daraus könnte man den Schluss ziehen, dass der Unterhaltsberechtigte das Einkommen des Unterhaltspflichtigen darzulegen und zu beweisen habe, weil grundsätzlich der Unterhaltsberechtigte seinen Bedarf zu beweisen hat. Allerdings folgt der BGH dem nicht und sieht die Darlegungslast für das Einkommen des Unterhaltspflichtigen auf dessen Seite, weil die Bedarfsbegrenzung nach Halbteilungsgrundsatz für ihn positive Auswirkung hat.

BGH, Urteil vom 15.12.2004 – XII ZR 121/03
Halbteilungsgrundsatz – Einkommensbereinigung und Erwerbstätigenbonus
Anmerkung:
Der BGH hat sich zur Lösung des Problems einer gerechten Verteilung der vorhandenen Mittel für eine entsprechende Anwendung des im ehelichen Unterhaltsrecht geltenden Grundsatzes der Halbteilung in seiner anspruchsbegrenzenden Funktion entschieden, was auch beinhaltet, dass ihm der beim Ehegattenunterhalt übliche Erwerbstätigenbonus – der eine Modifizierung des Halbteilungsgrundsatzes darstellt – zugute kommen.
Das gilt besonders auch für die Geltendmachung steuerlicher Vorteile (z.B. begrenztes Realsplitting; vgl. OLG Frankfurt, FuR 2019, 710; Franz-Thomas Roßmann, in: Viefhues et al., Das familienrechtliche Mandat – Unterhaltsrecht, § 5 Unterhalt nicht miteinander verheirateter Eltern nach § 1615l BGB).
Zweistufige Bedarfsermittlung
Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist nun eine zweistufige Bedarfsermittlung angezeigt:
- Stufe I – Bedarf nach Lebensstellung
Ebenso wie der Betreuungsunterhalt nach § 1570 BGB soll der Unterhaltsanspruch aus Anlass der Geburt eines Kindes nicht verheirateter Eltern (§ 1615l BGB) grundsätzlich den Karriereknick wegen Kinderbetreuung zum Ausgleich bringen. Der Unterhaltsbedarf wird nach Maßgabe der Lebensstellung (§§ 1615 l Abs.3 S.1 i.V.m. § 1610 Abs.1 BGB) des kinderbetreuenden Elternteils bestimmt (zweiter Bedarfsmaßstab; vgl. BGH, Beschluss vom 10.06.2015 – XII ZB 251/14).
Die Mutter muss ihren Unterhaltsbedarf konkret darlegen. Dies bedeutet, dass i.d.R. der Verdienstausfall der Mutter der Maßstab für die Ermittlung ihres Bedarfs ist. Hat sie vor der Geburt Erwerbseinkommen erzielt, richtet sich ihr Bedarf nach ihrem damaligen Einkommen.
- Stufe II – Kontrollberechnung

AG München, Beschluss vom 02.12.2021 – 529 F 1221/20
(intern vorhanden, unser Az.: 72/20)
Betreuungsunterhalt und Halbteilungsgrundsatz
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat) “Nach Zahlung des Betreuungsunterhaltes würde dem Antragsgegner weniger als der Selbstbehalt und auch weniger als die Hälfte seines Einkommens verbleiben. Aber auch bei Berücksichtigung des angemessenen Selbstbehalts wäre der Antragsgegner schlechter gestellt als bei der Zahlung von Trennungs- oder nachehelichem Ehegattenunterhalt.
Um diese Schlechterstellung des nichtehelichen Vaters zu vermeiden, kommt der im Ehegattenunterhalt geltende Halbteilungsgrundsatz auch im Rahmen des Unterhaltsanspruchs nach § 1615 l BGB zur Anwendung (vgl. statt vieler Wendl/Dose, aaO, § 7, Rdnr. 116, 117). Nach dem Halbteilungsgrundsatz kann die Antragstellerin daher lediglich die Hälfte des dem Antragsgegner verbleibenden bereinigten Einkommens beanspruchen”
Anmerkung:
Die Berechnung auf Stufe I hat zur Folge, dass der Unterhaltsanspruch der nicht verheirateten Mutter den Betreuungsunterhaltsanspruch der verheirateten Mutter übersteigen kann. Der Bedarf der Mutter wird jedoch in solchen Fällen (ähnlich § 1570 BGB) durch den Halbteilungsgrundsatz begrenzt (BGH FamRZ 2019, 1234, 1236).
Der Mutter steht nicht mehr Unterhalt zu, als dem Vater selbst verbleibt (OLG Saarbrücken, Beschluss vom 4.7.2013 – 6 UF24/13, NJW 2014, 559). Bei der deswegen anzustellenden vergleichenden Berechnung (Kontrollberechnung) ist der vergleichend herangezogene Unterhaltsanspruch einer ehelichen Mutter unter Heranziehung aller dort anerkannter Kriterien zu ermitteln.
Fiktives Einkommen des Vaters bei Kontrollberechnung?

AG Starnberg, Beschluss vom 23.05.2023 – 1 F 1040/21
(intern vorhanden; unser Az.: 95/21)
Keine Berücksichtigung von fiktiven Einkünften bei Anwendung des Halbteilungsgrundsatzes
Aus den Entscheidungsgründen:
a) Es entspricht gefestigter ständiger Rechtsprechung des BGH, dass bei der Bedarfsbemessung jedem Elternteil die Hälfte des verteilungsfähigen Einkommens zuzubilligen ist.
b) Der Bedarf kann hierbei nicht aus lediglich gedachten fiktiven Einkünften des Pflichtigen, die keine Grundlage in der tatsächlichen Einkommenssituation hatten, abgeleitet werden. Möglicherweise durch größeren Einsatz erzielbare, aber nicht erzielte Einkünfte sind daher nicht bedarfsbestimmend.
c) Auch der Vermögensstamm ist auf Bedarfsebene nicht zu berücksichtigen. Ob ein Teil des Vermögens zu verwerten wäre, könnte nur auf der Stufe der Leistungsfähigkeit berücksichtigt werden. Soweit die Antragstellerin vorträgt, dass der Antragsgegner über erhebliches Vermögen verfüge, ist dies daher an dieser Stelle unerheblich.
Anmerkung:
Hälftig aufzuteilen ist nur das verteilungsfähige Einkommen. Es ist zur Ermittlung des Bedarfs daher vorher zu bereinigen, d. h. um Steuern, Vorsorgeaufwendungen, berufsbedingte Aufwendungen, Kinderbetreuungskosten, etc. Bei Erwerbseinkünften ist ferner vorab vom bereinigten Nettoeinkommen bei der Quotierung des Unterhalts der Erwerbstätigenbonus abzuziehen (vgl. zum Ganzen Wendl/Dose UnterhaltsR, § 4 Ehegattenunterhalt Rn. 750 – 755, beck-online).
Bei der Bedarfsermittlung eines Ehegattenunterhalts findet fiktives Einkommen grundsätzlich keine Berücksichtigung. Wegen Halbteilungsgrundsatz gilt gleiches für die Einkommensermittlung des Vaters zur Begrenzung des Betreuungsunterhalts nach § 1615l BGB. Wir verweisen auf einen Fall aus unserer Praxis (AG Starnberg – 1 F 1040/21; unser Az.: 95/21) bei dem diese Frage hochumkämpft war.
Dazu haben wir wie folgt vorgetragen: Wenn die Antragstellerin meint, mit fiktiven Einkünften des Antragstellers zur Feststellung des Unterhaltsbedarfs oder mit Vermögensverwertung argumentieren zu können, dann vergisst sie zwischen den Grundsätzen zur Prüfungsebene Bedarf, Leistungsfähigkeit zu unterscheiden und die Anwendung des Halbteilungsgrundsatzes zu beachten. Der Hinweis auf die Literaturstelle Wendl/Dose, § 7 Rn 146 oder Rn 151 greift nicht.
Die Hinweise auf Wendl/Dose betreffen allesamt die Prüfungsebene der Leistungsfähigkeit. Die Ausführungen zur Bedarfsermittlung beim Betreuungsunterhalt finden sich bei Wendl/Dose unter § 7 Rn 91 bis 122. Hier sei konkret auf Wendl/Dose, § 7 Rn 118 hingewiesen: (Zitat) „Die abweichende Auffassung, die den Halbteilungsgrundsatz auf den Bedarf eines Anspruchs nach § 1615l BGB nicht anwenden, sondern das mit ihm verfolgte Ziel erst auf der Ebene der Leistungsfähigkeit umsetzen will, hat der BGH abgelehnt.
Die Berücksichtigung des Halbteilungsgrundsatzes führt zu einer Begrenzung des Unterhaltsbedarfs des nach § 1615l BGB berechtigten betreuenden Elternteils. Dieser beträgt nicht mehr als die Hälfte des für den Unterhalt zur Verfügung stehenden und nach den geläufigen unterhaltsrechtlichen Kriterien bereinigten Einkommens des Unterhaltspflichtigen. Handelt es sich um Erwerbseinkommen, so ist zuvor der Erwerbstätigenbonus abzuziehen.“
Somit dürfte allseits bekannt sein, dass im Rahmen des Halbteilungsgrundsatzes fiktives Einkommen als Bemessungsgrundlage keine Rolle spielt, es sei denn, einem der Beteiligten ist unterhaltsrechtliche Mutwilligkeit bei Unterlassen eines höheren Einkommens zu unterstellen (zum Bedarf und fiktives Einkommen: BGH, Urteil v. 20.11.1996 – XII ZR 70/95, in NJW 1997, 281; zur unterhaltsrechtlichen Mutwilligkeit: BGH, Urteil vom 10.11.1993 – XII ZR 113/92, in NJW 1994, 258).”
- Weiterführende Links:
» Bedarfsermittlung mit fiktiven Einkünften – Wann ist das der Fall?
Beweislast zur Unterhaltsbegrenzung nach Halbteilung und Einkommen des Unterhaltspflichtigen

BGH, Urteil vom 15.05.2019 – XII ZB 357/18
Bedarfsbegrenzung nach Halbteilungsgrundsatz
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat, Rn 35) „Zwar trägt der Unterhaltsberechtigte nach allgemeinen Grundsätzen die Darlegungs- und Beweislast für seinen Bedarf und seine Bedürftigkeit (Wendl/Dose Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis 9. Aufl. § 6 Rn. 703 ff.; Palandt/Brudermüller BGB 78. Aufl. § 1601 Rn. 20).
Zu Recht verweist die Rechtsbeschwerde aber darauf, dass sich die Unterhaltsbegrenzung nach dem Halbteilungsgrundsatz bzw. der Dreiteilungsmethode zum Nachteil der Unterhaltsberechtigten auswirkt und es sich damit um eine an sich in die Sphäre des Unterhaltspflichtigen fallende Darlegung handelt (vgl. Senatsurteil vom 14. April 2010 – XII ZR 89/08 – FamRZ 2010, 869 Rn. 36 zur früheren Rechtsprechung; Senatsurteil BGHZ 192, 45 = FamRZ 2012, 281 Rn. 39; NK-BGB/Schilling 3. Aufl. § 1615 l Rn. 56).
Es geht damit im Ausgangspunkt um nichts anderes als um eine Begrenzung des Anspruchs auf Betreuungsunterhalt nach § 1615 l Abs. 2 Satz 2 BGB.“
Anmerkung:
Ist das Einkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils nicht bekannt, soll jedoch der Bedarfsbegrenzung nach Halbteilungsgrundsatz beim Betreuungsunterhalt dienen, muss der Unterhaltspflichtige zu seinem Einkommen vortragen. Der unterhaltsberechtigte Elternteil muss also nicht vorab ein gerichtliches Auskunftsverfahren anstreben.
Will der Unterhaltspflichtige den Unterhaltsbedarf mittels Kontrollberechnung nach Halbteilung oder Dreiteilungsmethode begrenzen, muss dieser sein Einkommen darlegen. Für den Bedarf und seine Bemessungsgrundlagen ist grundsätzlich der Unterhaltsberechtigte darlegungs- und beweisbelastet (vgl. OLG München, Beschluss v. 18.07.2018 – 12 UF 202/18, Rn 57; OLG Bamberg, Endurteil vom 27.11.2014, FamRZ 2015, 882).
Beweislastverteilung:
Weil die Kontrollrechnung auf der Ebene der Bedarfsermittlung angesiedelt ist, wird die Beweislast für die Bemessungsgrundlagen für die Anwendung des Halbteilungsgrundsatzes z.T. beim Unterhaltsberechtigten gesehen. Der BGH hat in der Entscheidung vom 15.05.2019 klargestellt, dass wegen der Beweislastverteilung nach Sphärentheorie der Unterhaltspflichtige für die Unterhaltsbegrenzung darlegungsbelastet ist.
- Weiterführende Links:
» Auskunftspflicht zum Einkommen
» Darlegungs- und Beweislast für Begrenzung des Ehegattenunterhalts
» AG München – 529 F 12210/20, Auskunftsantrag zum Einkommen des Unterhaltspflichtigen, unser Az.: 72/20 (D3/836-20)
Bedarfsermittlung mit Halbteilungsgrundsatz, wenn die Mutter nach Geburt des Kindes kein Einkommen erzielt.
Situation:
Die unterhaltsberechtigte Mutter hat bis zur Geburt des Kindes ein bereinigtes Netto-Einkommen in Höhe von 2.200 € erzielt. Das bereinigte Netto-Einkommen des unterhaltspflichtigen Vaters beträgt nach Abzug des Kindesunterhalts 3.500 € (verfügbares Einkommen). Der nach Lebensstellung der Mutter ermittelte Bedarf beträgt 2.200 €. Müsste der Vater diesen Bedarf decken, verblieben ihm 1.300 € (= 3.500 € – 2.200 €). Die Mutter hätte dagegen 2.200 € (ohne eigenen Erwerbseinkommen wegen Kinderbetreuung) zur Verfügung. Im Ergebnis verbliebe dem Vater mit 1.300 € weniger als die Hälfte seines bereinigten Netto-Einkommens, d.h. weniger als 1.750,00 € (= 3.500,00 € x 1/2).
Begrenzung nach Halbteilungsgrundsatz:
Wenn beide Eltern miteinander verheiratet gewesen wären, würde der Betreuungsunterhalt der Mutter sich aus § 1570 BGB ergeben und der Bedarf nach den ehelichen Lebensverhältnissen und Halbteilungsgrundsatz bestimmt. Nach Wegfall des Erwerbseinkommens der Mutter wegen Kinderbetreuung würde der Betreuungsunterhalt nach der Differenzmethode bestimmt werden.
Danach bestimmt sich der Betreuungsunterhalt nach folgender Formel: 3.500 € (Einkommen des Vaters) bereinigt um 350,00 € (Erwerbstätigenbonus = 10 % vom bereinigten Einkommen) = 3.150,00 € x 1/2 (Hälfte der Differenz zwischen den Elterneinkommen) = 1.575,00 €.
Fazit: Der Bedarf der Mutter an Betreuungsunterhalt in Höhe von 2.200 € (nach eigener Lebensstellung) wird auf den (fiktiv ermittelten ehelichen) Bedarf nach Halbteilungsgrundsatz auf maximal 1.575,00 € begrenzt.
Bedarfsermittlung mit Halbteilungsgrundsatz, wenn die Mutter nach Geburt des Kindes weiterhin Einkommen erzielt.
Das Einkommen der Mutter vor der Geburt markiert nur im ersten Schritt den maximal möglichen Bedarf (Bedarfsmaßstab: Karriereknick gem. eigener Lebensstellung). Der eigene angemessene Unterhaltsbedarf des Vaters soll nicht geringerer sein, als das eigene Einkommen der Mutter zuzüglich des geschuldeten Unterhalts (Bedarfsmaßstab: Halbteilungsgrundsatz).
Beispiel:
- Einkommen der Mutter vor Geburt des Kindes: 6.000 € (= voller Bedarf)
- Anrechenbares Einkommen der Mutter nach Geburt des Kindes: 2.000 € (inkl. Elterngeld und Betreuungsgeld) – Ob das Einkommen aus Erwerbstätigkeit dabei zur vollen oder nur teilweisen Einkommensanrechnung kommt, beurteilt sich danach, ob es sich um zumutbares oder überobligatorisches Einkommen handelt.
- Einkommen des Vaters – bereinigt von dessen Kindesunterhaltslasten und Erwerbstätigenbonus: 2.500 € (verfügbares Einkommen)
- Bedarf der Mutter wegen Begrenzung des Bedarfs nach Halbteilungsgrundsatz:
Gesamteinkommen der Eltern 4.500 € x 1/2 = 2.225 € (begrenzter Bedarf) - Bedürftigkeit = 2.225 € abzgl. eigenes Einkommen (2.000 €) = 225 €.
- Wegen der Halbteilung des verfügbaren Einkommens werden im Ergebnis Vater und Mutter jeweils 2.225 € zur Verfügung stehen.
Weiterführende Rechtsprechung & Literatur:
» Wendl/Dose, Unterhaltsrecht, 10. Auflage, § 7, Rn 116 ff.
» BGH, Urteil vom 15.12.2004 – XII ZR 121/03, Rn 13 ff.; bestätigt durch BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 13.02.2018, 1 BvR 2795/16)
4. Bedarfsmaßstab: Mindestbedarf

BGH, Beschluss vom 16.12.2009 – XII ZR 50/08
Mindestbedarf-Existenzminimum
Leitsatz:
Der Unterhaltsbedarf wegen Betreuung eines nichtehelich geborenen Kindes bemisst sich jedenfalls nach einem Mindestbedarf in Höhe des Existenzminimums, der unterhaltsrechtlich mit dem notwendigen Selbstbehalt eines Nichterwerbstätigen pauschaliert werden darf (im Anschluss an das Senatsurteil BGHZ 177, 272, 287 = FamRZ 2008, 1738, 1743).
5. Bedarfsmaßstab: Konkreter Bedarf?

OLG Köln, Beschluss vom 21.02.2017 – 25 UF 149/16
Betreuungsunterhalt nach § 1615l BGB bei gehobenen Einkommensverhältnissen
Frage: Gilt die konkrete Bedarfsermittlungsmethode, wie beim Ehegattenunterhalt?
Das OLG Köln (2017) sagt „nein“und erklärt dazu in seiner Beschlussbegründung (Zitat, Rn 55 ff.): „Von dem Anknüpfungspunkt für die Beurteilung des Betreuungsunterhalts gemäß § 1615 l BGB an die Lebensstellung vor Geburt und Betreuung zu unterscheiden ist die Darlegungsbedürftigkeit des Unterhaltsbedarfs (OLG Zweibrücken, Urteil vom 21.09.1999 – 5 UF 16/99 – juris, Rn 27; OLG Köln, a.a.O., Rn 3). Diese Darlegung wird von der betreuenden Mutter verlangt.
Indes bedeutet dies nicht, (…), dass der konkrete Bedarf wie beim Ehegattenunterhalt darzulegen ist. Abzustellen ist vielmehr, wie vorstehend dargelegt, auf das vor der Geburt erzielte nachhaltige Erwerbseinkommen, soweit nicht im Rahmen der vorgenannten Prognose ein anderes Einkommen zugrundezulegen ist, sowie auf die Vermögensverhältnisse (BGH, Beschluss vom 10.06.2015 – XII ZB 251/14 –, a.a.O., Rn 34 juris; Urteil vom 16.12.2009 – XII ZR 50/08 –, a.a.O., Rn 17 juris; Urteil vom 05.07.2006 – XII ZR 11/04 – FamRZ 2006, 1362, Rn 43; OLG Köln, a.a.O.; Viefhues in: juris PK-BGB, 8. Auflage, § 1615 l Rn. 140; ders. in: FuR 2015, 686, 690; Bömelburg, a.a.O., § 7 Rn. 100)”.
Bedürftigkeit
kinderbetreuender Eltern
Anrechnung des Einkommens des kinderbetreuenden Elternteils nach Maßgabe der Erwerbsobliegenheit
Bedürftigkeit:
Auf der Prüfungsebene der Bedürftigkeit zum Unterhaltsanspruch wird nun danach gefragt, in welchem Umfang der kinderbetreuende Elternteil seinen Geldbedarf mit eigenen wirtschaftlichen Mitteln (unterhaltsrelevantes Einkommen und Vermögen) decken kann bzw. decken muss. Nur soweit sich danach eine offene Bedarfslücke zeigt, ist diese über den Betreuungsunterhaltsanspruch nach § 1615 l BGB vom anderen Elternteil zu schließen.
Anrechenbares Eigeneinkommen:
Liegt ein Verstoß gegen die Erwerbsobliegenheit des kinderbetreuenden Elternteils vor, wird das erzielbare fiktive Einkommen auf den Bedarf angerechnet. Übersteigt die Erwerbstätigkeit den Rahmen der zugemuteten Erwerbsobliegenheit, wird von überobligatorischer Tätigkeit gesprochen. In diesem Fall wird das erzielte Einkommen nur teilweise dem unterhaltsrelevanten Einkommen zugerechnet.
- Weiterführende Links:
» Job & Kind – Erwerbsobliegenheiten neben Kinderbetreuung
In welcher Höhe wird überobligatorisch erzieltes Einkommen zugerechnet?
| Leitfaden
Unterhaltsrechtliche Bewertung von überobligatorischem
Einkommen kinderbetreuender Eltern
Situation:
Die Mutter führt Ihre vor Geburt des Kindes ausgeübte freiberufliche Tätigkeit auch nach Geburt des Kindes fort. Frage ist hier, inwieweit das nach Geburt des Kindes erzielte Einkommen auf den Bedarf nach Halbteilungsgrundsatz als überobligatorisches Einkommen anrechnungsfrei bleibt.
Grundsätze:
- Einkommen in den ersten drei Jahren nach der Geburt: Überobligatorisch ist Einkommen dann, wenn es aus einer unzumutbaren Erwerbstätigkeit stammt. Erwerbseinkünfte in den ersten drei Jahren nach Geburt des Kindes sind überobligatorisch, da der Elternteil aufgrund der Betreuung eines unter 3-jährigen Kindes grundsätzlich nicht zu einer Erwerbstätigkeit verpflichtet ist (Wendl/Dose, Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis, 10. Aufl., § 1, Rdnr. 800 ff.).
Der Zumutbarkeitsmaßstab gem. § 1615l Abs. 2 BGB für die Obliegenheit zur Erwerbstätigkeit ist wegen des insoweit mit § 1570 BGB übereinstimmenden Wortlauts der gleiche, wie beim Kinder betreuenden Ehegatten nach Scheidung (OLG Hamburg, Beschluss vom 28.07.2004 – 2 UF 73/03). - Anrechnung überobligatorischen Einkommens auf den Bedarf:
- Werden Einkünfte aus überobligatorischer Tätigkeit erzielt, führt jedoch nicht dazu, dass die Einkünfte gar nicht zu berücksichtigen sind, sondern lediglich zu einem angemessenen Teil (vgl. Wendl/Dose, Unterhaltsrecht, Rdnr. 827a). Meist halten Gericht einen hälftigen Ansatz der tatsächlich erzielten Einkünfte für angemessen.
- Wenn die Mutter die vor der Geburt des Kindes ausgeübte Erwerbstätigkeit fortführt, gelten zur Anrechenbarkeit des eigenen Einkommens der Mutter die Grundsätze nach § 1577 Abs.2 BGB gelten entsprechend, (BGH, Urteil vom 15.12.2004 – XII ZR 121/03); vgl. Wendl/Dose Unterhaltsrecht, 10. Auflage, § 7, Rn 131 ff.).
- Einkommensbereinigung: Die eigenen Einkünfte der Berechtigten bleiben anrechnungsfrei, soweit sie zum Bestreitung von der Kinderbetreuungskosten erforderlich sind (BGH, Beschluss vom 15.05.2019 – XII ZB 357/18, Rn 19 ff.)
- Weiterführende Links und Literatur:
» zur Anrechnung von zumutbarem und überobligatorischem Einkommen
» Büte, Unterhaltsansprüche der Mutter von nichtehelichen und ehelichen Kindern, in FK Familienrecht kompakt 2006, 206.
- Weiterführende Links und Literatur:
Anrechnung des Mutterschaftsgeldes
Das Mutterschaftsgeld wird grundsätzlich auf den Betreuungsunterhalt nach § 1615l BGB angerechnet, da es als Ersatz für entfallendes Einkommen der Mutter dient. Während der Mutterschutzfrist, also sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt, erhält die Mutter Mutterschaftsgeld von der Krankenkasse, gegebenenfalls ergänzt durch einen Zuschuss des Arbeitgebers. Da diese Zahlung das bisherige Einkommen ersetzt (“Lohnersatzfunktion”), wird sie vollständig auf den Unterhaltsbedarf angerechnet.
Ist das Mutterschaftsgeld hoch genug, kann es den Anspruch auf Betreuungsunterhalt während dieses Zeitraums ganz oder teilweise ausschließen. Sobald die Mutterschutzfrist endet und keine anderen Einkünfte vorhanden sind, lebt der Unterhaltsanspruch wieder in voller Höhe auf. Sollte die Mutter vor der Geburt kein eigenes Einkommen gehabt haben, erfolgt keine Anrechnung, da kein Verdienstausfall ausgeglichen wird.
Zusammenfassend bedeutet das: Während der Mutterschutzfrist kann sich der Betreuungsunterhalt reduzieren oder entfallen, danach besteht der Anspruch auf Unterhalt für die Betreuung des Kindes wieder uneingeschränkt, sofern keine weiteren Einkünfte vorliegen.
Anrechnung des Elterngeldes

BGH, Urteil vom 10.11.2010 – XII ZR 37/09
Ist das Elterngeld unterhaltsrelevantes Einkommen, das die Bedürftigkeit der Mutter nach Unterhalt mindert?
Leitsatz: “Elterngeld wird grundsätzlich einkommensabhängig gezahlt, so dass es Lohnersatzfunktion hat und deswegen als Einkommen des bezugsberechtigten Elternteils zu berücksichtigen ist. Lediglich in Höhe von 300 € monatlich [Sockelbetrag] bleibt es nach § 11 Satz 1 BEEG unberücksichtigt.”
- Weiterführende Links:
» Elterngeld.net
» Elterngeldrechner
» Erwerbsobliegenheit bei Elterngeldbezug - Rechtsprechung zum Elterngeld:
» BGH, Urteil vom 12.04.2006 – XII ZR 31/04: Elterngeld als Surrogat für die ansonsten bestehende Erwerbsobliegenheit.
» BGH, Urteil vom 18.02.2012 – XII ZR 73/10, Rn 14
» BGH, Beschluss vom 11.02.2015 – XII ZB 181/14, Rn 19
Anrechnung des Erziehungsgeldes: Die Rechtsprechung zum Erziehungsgeld betrifft Altfälle. Das Erziehungsgeld wurde durch das Elterngeld abgelöst.

BGH, Urteil vom 21. Juni 2006 – XII ZR 147/04
Wann ist Erziehungsgeld unterhaltsrelevantes Einkommen?
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat, Rn 17ff.) “Das Erziehungsgeld hat keine Lohnersatzfunktion, sondern wird auch an Eltern gezahlt, die zuvor nicht erwerbstätig waren.
(…) Nach übereinstimmender Auffassung ist das Erziehungsgeld deswegen im Regelfall nicht als anrechenbares Einkommen bei der Bemessung von Unterhaltsansprüchen zu berücksichtigen (BVerfG FamRZ 2000, 1149). (…) Dies gilt nach § 9 Satz 2 BErzGG allerdings nicht in den Fällen des § 1361 Abs. 3 der §§ 1579 (grobe Unbilligkeit beim Ehegattenunterhalt), 1603 Abs. 2 (gesteigerte Erwerbsobliegenheit) und des § 1611 Abs. 1 BGB (grobe Unbilligkeit beim Verwandtenunterhalt).
Anrechnung des Betreuungsgeldes
Der Unterhalt nach § 1615l BGB kann nicht in voller Höhe des ursprünglichen Bedarfs bestehen, wenn der kinderbetreuende Elternteil berechtigt ist, das sog. Betreuungsgeld in Höhe von € 150,– monatlich zu beantragen und selbstverständlich auch zu erhalten.
Mit dem Betreuungsgeld hat der Gesetzgeber eine Leistung eingeführt, die auch diejenigen Familien finanziell unterstützen will, die ihren Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung für ihr Kind nicht oder nicht gleich ab dem vollendeten 1. Lebensjahr geltend machen wollen. Wenn im Unterhaltsverfahren nichts Gegenteiliges vorgetragen wird, kann vom Bezugsrecht des Betreuungsgeldes ausgegangen werden.
Dieses Betreuungsgeld erhalten Eltern, deren Kind ab dem 01.08.2012 geboren wurde und die für ihr Kind keine Leistung nach § 24 Abs. 2 SGB VIII in Anspruch nehmen, auch hiervon ist im Regelfall in einem Unterhaltsverfahren auszugehen. Die Bezugszeit von längstens 22 Monaten schließt nahtlos an die 14- monatige Rahmenbezugszeit für das Elterngeld. Damit verringert sich automatisch der Bedarf um monatlich € 150,–€ Betreuungsgeld.
- Literaturhinweis:
Herbert Grziwotz, Betreuungsgeld – Herdprämie oder Familienleistung?, in: FF 2016, 349
Anrechnung des Vermögensstamms – Obliegenheit zur Verwertung für den Lebensunterhalt?
- Vermögenserträge:
Einnahmen aus Vermögen, die schon vor der Geburt erzielt worden sind, haben auf die Höhe des Betreuungsunterhalts keinen Einfluss (OLG Köln, Beschluss vom 21.2.2017 – 25 UF 149/16). - Obliegenheit zur Vermögensverwertung:
Mit Verweis des § 1615l Abs.3 S.1 BGB auf § 1602 Abs.1 BGB zeigt sich, dass der Unterhaltsberechtigte, bevor er Unterhalt fordern kann, zunächst den Stamm seines Vermögens zu verwerten hat. Aus dem Verweis folgt grundsätzlich eine Gleichstellung mit den Grundsätzen des Vermögenseinsatzes unterhaltsbedürftiger volljähriger Kinder:
Diesen verbleibt – bis auf einen Notgroschen – nur ein minimales Schonvermögen. Die Gleichstellung von alleinerziehenden Eltern mit unterhaltsbedürftigen volljährigen Kindern ist allerding sehr umstritten. Bei der Frage nach der Verwertungsobliegenheit wird alternativ die Situation mit dem Unterhalt für Eltern wegen aus einer Ehe stammenden Kindern verglichen.
Billigkeitsabwägung bei Verwertungsobliegenheit?
An dieser Stelle wird immer wieder die Gleichbehandlung des Betreuungsunterhalts nach § 1615l BGB mit dem Betreuungsunterhalt für verheiratete Eltern nach § 1570 BGB gefordert. Denn einem unterhaltsbedürftigen und kinderbetreuenden Ehegatten wird wegen § 1577 Abs.3 BGB generell ein weitaus umfangreicheres Schonvermögen zugestanden als einem volljährigen Kind.
Auch der Wortlaut des § 1570 Abs.3 BGB eröffnet mit dem Abstellen auf die “Billigkeit” einen großen Ermessensspielraum für die Familiengerichte bei der Einzelfallbewertung, ob dem Unterhaltsberechtigten lediglich ein Notgroschen zu verbleiben hat (mehr dazu bei Wever, in: Schnitzler, Münchener Anwaltsandb. FamR, 4. Aufl. 2014, § 10 Rn 72ff.).
Somit existiert in der Praxis beim Thema Vermögenseinsatz zur Unterhaltsbedarfsdeckung häufig Streit. Je nachdem, ob die Nähe vom Verwandtenunterhalt oder die Nähe zum Betreuungsunterhalt nach § 1570 BGB betont wird, wird die Obliegenheit zur Vermögensverwertung bejaht oder verneint.
Eine eindeutige Rechtsprechung existiert dazu nicht. Wegen der höchstrichterlich gewünschten Angleichung der Unterhaltsansprüche aus § 1615l Abs.2 S.2 BGB (nicht verheiratete Eltern) und § 1570 BGB (verheiratete Eltern) besteht auch in der Literatur Einigkeit darüber, dass die grundsätzliche Verpflichtung zur Verwertung des Vermögensstamms durch eine umfassende Zumutbarkeits- und Billigkeitsprüfung einzuschränken ist (vgl. Wendl/Dose, Das Unterhaltsrecht in der familienrechtlichen Praxis, 10. Aufl. 2019, § 7, Rn 138 ff.).
Hinweis für die Praxis: Ist festzustellen, dass der kinderbetreuende Elternteil Vermögen besitzt, muss der Unterhaltspflichtige dazu vortragen, dass er aus diesem Grund zu Unterhaltsleistungen nicht verpflichtet sei. Jetzt trifft den Unterhaltsberechtigten die Darlegungs- und Beweislast, dass ihm eine Vermögensverwertung nicht zumutbar sei, weil es nicht der Billigkeit entspricht. Hier muss nun umfassender Sachvortrag zu Kriterien für eine Billigkeitsabwägung folgen. In jedem Fall ist für den Unterhaltspflichtigen angezeigt einen Anspruch auf Auskunft zum unterhaltsrelevanten Vermögen geltend zu machen.
Kriterien für die Billigkeitsabwägung zur Verwertungsobliegenheit:
- wirtschaftliche Situation des Bedürftigen und des Unterhaltspflichtigen sowie
- die Relation ihrer Vermögen zueinander.
- Beachtlich für die Zumutbarkeit der Vermögensverwertung ist, dass der unterhaltsberechtigte Elternteil sein Vermögen vorrangig zum Ausgleich der Einbußen benötigt, die er durch die Kinderbetreuung und den damit verbundenen Karriereknick und in der eigenen Altersversorgung erleidet.
- Einzelfälle zum Schonvermögen beim Betreuungsunterhalt zwischen 30.000 € und 190.000 € bei Wendl/Dose, Unterhaltsrecht, 10. Aufl. 2019, § 7, Rn 140).
- Weiterführende Links:
Zur Berechnung des geschonten Altersvorsogevermögens
- Weiterführende Links:
Rechtsprechung zum Vermögenseinsatz und Billigkeitsabwägung:

OLG Oldenburg, Hinweisbeschluss vom 05.05.2023 – 13 UF 88/19
(intern vorhanden, Az.: 101/19)
zur Verwertung des Vermögensstamms des Unterhaltsberechtigten
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat) “Zwar muss der nach § 1615l BGB Unterhaltsberechtigte gemäß §§ 1615l Abs. 3 Satz 1, 1602 Abs. 2 BGB, bevor er Unterhalt fordern kann, zunächst den Stamm seines Vermögens verwerten. Gleichwohl besteht unter Berücksichtigung der durch die Rechtsprechung des BGH eingeleiteten und mit dem am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen UÄndG fortgeführten weitgehenden Angleichung der Unterhaltsansprüche aus § 1615l Abs.2 Satz 2 BGB und § 1570 BGB sowohl in der Rechtsprechung als auch in der Literatur Einigkeit darüber, dass die grundsätzliche Verpflichtung zur Verwertung des Vermögensstamms durch eine umfassende Zumutbarkeits- und Billigkeitsprüfung einzuschränken ist (vgl. Wendl/Dose- Bömelburg, Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis, 10. Aufl. 2019, § 7 Rdnr. 138 f. m. w. N.).
Anmerkung:
Kriterien für eine solche Prüfung sind unter anderem die wirtschaftliche Situation des Bedürftigen und des Unterhaltsverpflichteten sowie die Relation ihrer Vermögen zueinander. Beachtlich ist insbesondere, dass der Unterhaltsberechtigte sein Vermögen vorrangig zum Ausgleich der Einbußen benötigt, die er durch die Kinderbetreuung und die damit verbundenen Defizite in seiner beruflichen Entwicklung und in der eigenen Altersversorgung erleidet.
So kann eine Zumutbarkeitsprüfung ergeben, dass ein erhebliches Vermögen des betreuenden Elternteils nicht zur Deckung der Kosten für den Lebensunterhalt eingesetzt werden muss, weil es für die Alterssicherung benötigt wird.
Wenn der Unterhaltspflichtige über ein größeres Vermögen verfügt und seine Altersversorgung gesichert ist, kann es unbillig erscheinen, dem Unterhaltsberechtigten die Verwertung eines erheblich geringeren Vermögens anzusinnen, auch wenn dieses die Grenze einer Rücklage für die Notzeiten, mithin den Notgroschen, überschreitet (vgl. Wendl/Dose-Bömelburg, a. a. O, § 7 Rdnr. 140 m. w. N.). Eine derartige Konstellation ist im vorliegenden Fall gegeben, [….]”

OLG Köln, Beschluss vom 21.2.2017 – 25 UF 149/16
Zum Vermögenseinsatz und Bedürftigkeit beim Betreuungsunterhalt
Leitsätze:
Einnahmen aus Vermögen, die schon vor der Geburt erzielt worden sind, haben auf die Höhe des Betreuungsunterhalts keinen Einfluss. Wer Anspruch auf Betreuungsunterhalt hat, muss den eigenen Vermögensstamm nur angreifen, soweit dies nicht unwirtschaftlich oder unter Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Interessen unbillig wäre.

KG Berlin, Urteil vom 24. Juni 2003 – 18 UF 418/02
Zum Vermögenseinsatz und Bedürftigkeit beim Betreuungsunterhalt
Orientierungssatz:
Die Mutter eines nichtehelichen Kindes, die Betreuungsunterhalt gemäß § 1615l Abs. 2 BGB wegen Betreuung während der ersten drei Lebensjahre des Kindes geltend macht, muss sich nicht darauf verweisen lassen, sie müsse ihren Vermögensstamm (hier: Verbrauch von Spargeld und/oder Verwertung eines Aktiendepots) einsetzen, um ihren Bedarf zu decken.
Denn sie benötigt das Vermögen zum Ausgleich der Einbußen, die sie in ihrer Altersversorgung dadurch erleidet, dass sie das gemeinsame Kind betreut und ihre Erwerbstätigkeit zu diesem Zweck für drei Jahre unterbrochen und danach reduziert hat.
Es würde dem Gerechtigkeitsgefühl in unerträglicher Weise widersprechen, wenn die Kindesmutter ihr (kleines) Vermögen aufzehren müsste, um ihren angemessenen Lebensbedarf zu bestreiten und darüber hinaus noch langfristige Einbußen ihrer Altersversorgung hinzunehmen hätte, während der Kindesvater, der in sehr guten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, sein Vermögen dadurch vermehren könnte, weil er keinen Unterhalt an die Kindesmutter zu zahlen hätte.

BGH, Urteil v. 5.7.2006 – XII ZR 11/04
Zum Vermögenseinsatz und Bedürftigkeit beim Betreuungsunterhalt
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat) “Soweit die Kl. über ein restliches Vermögen in Form von Wertpapieren und den Vermögensstamm aus dem Verkauf des Reihenhauses verfügt, hat das OLG eine Verwertung wegen der besonderen Umstände des Einzelfalles hingegen zu Recht abgelehnt.
Denn die Kl. muss dieses Vermögen für ihre eigene Alterssicherung einsetzen, während der Bekl. als Unterhaltsschuldner in guten Einkommensverhältnissen lebt, ebenfalls vermögend ist und seine Altersversorgung hinreichend gesichert weiß. Auch das hält sich im Rahmen des tatrichterlichen Ermessens und ist von Rechts wegen nicht zu beanstanden.”
Leistungsfähigkeit des unterhaltspflichtigen Elternteils
Angemessener Eigenbedarf
- Die untere Grenze der Inanspruchnahme bildet der angemessene Eigenbedarf (Selbstbehalt) des Unterhaltspflichtigen. § 1615l Abs.3 S.1 BGB verweist auf die entsprechende Anwendung von § 1603 Abs.1 BGB. Danach ist nicht unterhaltspflichtig, wer bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande ist, ohne Gefährdung seines angemessenen Unterhalts den Unterhalt zu gewähren. Nur soweit Einkommen und unterhaltsrelevantes Vermögen vorhanden ist, das den Selbstbehalt übersteigt, ist der Unterhaltspflichtige leistungsfähig.
- Eigenbedarfsgrenze beim Betreuungsunterhalt: Aufgrund der Vergleichbarkeit mit dem Anspruch auf Betreuungsunterhalt zwischen Ehegatten, liegt der angemessene Eigenbedarf in der Regel zwischen dem angemessenen Selbstbehalt gegenüber volljährigen Kindern (§ 1603 I BGB) und dem notwendigen Selbstbehalt gegenüber minderjährigen Kindern (§ 1603 II BGB): BGH, Urteil vom 15.03.2006 – XII ZR 30/04.
- Weiterführende Links:
» Prüfungsebene Leistungsfähigkeit
Fiktives Einkommen und Obliegenheit zur Vermögensverwertung
Auf der Prüfungsebene der Leistungsfähigkeit kommt es aber nicht auf das real erzielte, sondern vielmehr aus das fiktiv erzielbare Einkommen an. Weiter kann eine Obliegenheit zur Verwertung vorhanden Vermögens gegen die Leistungsunfähigkeit sprechen:

OLG Hamm, Beschluss vom 03.11.2010 – 8 UF 138/10
Leistungsfähigkeit bei vorübergehender Arbeitslosigkeit – Obliegenheit zur Vermögensverwertung
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat) „Darüber hinaus wäre es dem Antragsgegner auch zumutbar, den Stamm seines Vermögens einzusetzen, um vorübergehend den geschuldeten Unterhalt aufzubringen. Selbst wenn man die Maßstäbe für den Einsatz des Vermögensstamms nicht den nach § 1615 l Abs. 3 S. 1 BGB anwendbaren Vorschriften über den Verwandtenunterhalt entnimmt, sondern die Regelung des § 1581 S. 2 BGB für die Leistungsfähigkeit beim nachehelichen Unterhalt analog heranzieht, würde sich nichts anderes ergeben.
Für eine solche analoge Heranziehung dürfte sprechen, dass im Rahmen einer umfassenden Zumutbarkeitsabwägung auf der Grundlage des § 1603 Abs. 1 BGB der weitgehenden Angleichung des Anspruchs an den nachehelichen Betreuungsunterhalt Rechnung zu tragen ist (Wendl/Staudigl-Dose, § 1 Rn 422). […] Die Kriterien des § 1581 S. 2 BGB rechtfertigen vorliegend den Einsatz des Vermögensstamms zumindest zur Überbrückung einer gewissen Zeit der Arbeitslosigkeit.”
Anmerkung:
Im Fall des OLG Hamm ging es um die vorübergehende, kurzfristige Arbeitslosigkeit eines angestellten Arztes von etwa 4 1/2 Monaten. Es ist allgemein anerkannt, dass vorübergehende Einkommensschwankungen nicht die Prüfungsebene der Bedarfsermittlung tangieren und damit auch nicht im Rahmen des Halbteilungsgrundsatzes zu berücksichtigen sind. Nur nachhaltige Einkommensveränderungen haben Einfluss auf die Bedarfsermittlung. Bedarfsermittlung ist auf eine langfristig angelegte Zukunftsprognose ausgerichtet.
Befristung und Begrenzung
Unterhaltsbefristung auf drei Jahre nach Geburt des Kindes?

BGH Beschluss v.02.10.2013 – XII ZR 249/12
Zur Begrenzung des Betreuungsunterhalts
Leitsatz:
Ebenso wie beim Betreuungsunterhalt nach § 1570 BGB ist auch ein Antrag auf künftigen Betreuungsunterhalt gemäß § 1615l BGB nur dann abzuweisen, wenn im Zeitpunkt der Entscheidung für die Zeit nach Vollendung des dritten Lebensjahres absehbar keine kind- und elternbezogenen Verlängerungsgründe mehr vorliegen (im Anschluss an Senatsurteil BGHZ 180, 170 = FamRZ 2009, 770).
Grundsätze:
- Der betreuende Elternteil kann bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes frei entscheiden, ob er die Betreuung persönlich übernimmt. Selbst wenn er schon in dieser Zeit eine Erwerbstätigkeit ausgeübt hatte, kann er sie jederzeit als überobligatorisch wieder aufgeben.
- Für eine Verlängerung des Betreuungsunterhalts über die Vollendung des 3. Lebensjahres hinaus hat der betreuende Elternteil stets individuelle Umstände vorzutragen (BGH Urteile vom 13. Januar 2010 – XII ZR 123/08). Denn ein pauschales Altersphasenmodell, das für die Dauer des Betreuungsunterhalts über die Vollendung des dritten Lebensjahres hinaus allein oder überwiegend auf das Alter des Kindes abstellt und die Umstände des Einzelfalles nicht berücksichtigt, wird der gesetzlichen Regelung nicht gerecht.
- Dabei ist auch die Anzahl der zu betreuenden Kinder und der Umstand zu berücksichtigen, dass kein abrupter Wechsel von einer Vollzeitbetreuung zur Vollzeiterwerbstätigkeit erfolgen muss.
- Nutzt der Elternteil in dieser Zeit allerdings eine Betreuungsmöglichkeit in einer öffentlichen und kindgerechten Einrichtung, ist ihm eine anteilige Erwerbstätigkeit zumutbar; Unabhängig davon ist der betreuende Elternteil nicht stets in dem Umfang erwerbspflichtig, in dem die Betreuung des Kindes in öffentlichen Einrichtungen sichergestellt ist, weil dies zu einer überobligatorischen Gesamtbelastung führen würde.
Steht für ein dreijähriges Kind lediglich ein Halbtagsplatz im Kindergarten zur Verfügung, bleibt dem betreuenden Elternteil regelmäßig lediglich die Möglichkeit zur Übernahme einer geringfügigen Erwerbstätigkeit. Neben der Betreuung des Kindes in einem Vollzeitkindergarten ist der Elternteil nicht sogleich zu einer Vollzeiterwerbstätigkeit, sondern – je nach Umständen des Einzelfalles – regelmäßig zu einer Erwerbstätigkeit zwischen 20 und 30 Wochenstunden verpflichtet. - Kindbezogene Verlängerungsgründe liegen vor, wenn keine vollzeitige Betreuung in einer öffentlichen Einrichtung möglich oder dies im Einzelfall nicht mit dem Kindeswohl vereinbar ist.
- Eine Fortdauer des Betreuungsunterhalts kann auch aus elternbezogenen Gründen gerechtfertigt sein.
- Erst wenn das Kind einen Entwicklungsstand erreicht hat, in dem es sich unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles zeitweise sich selbst überlassen bleiben kann, kommt es aus kindbezogenen Gründen nicht mehr auf eine vorrangig zu prüfende Betreuungsmöglichkeit in einer kindgerechten Einrichtung an (BGH, Urteile vom 30. März 2011 – XII ZR 3/09; vom 15. September 2010 – XII ZR 20/09 Rn. 22 und vom 6. Mai 2009 – XII ZR 114/08 Rn. 33).
Keine grundsätzliche Befristung auf drei Jahre:
Der Betreuungsunterhalt ist nach der zum 1. Januar 2008 in Kraft getretenen gesetzlichen Neuregelung der §§ 1570, 1615 l Abs. 2 BGB immer dann unbefristet zuzusprechen, wenn ein teilweiser oder vollständiger Wegfall des Anspruchs noch nicht sicher prognostiziert werden kann (BGH, Urteil vom 18. März 2009 – XII ZR 74/08). Nach der neuesten Rechtsprechung des BGH spricht viel dafür (wird vermutet), dass der einheitliche Unterhaltsanspruch dem Grunde nach in einer nach den Umständen des Einzelfalles zu bemessenden Höhe über die Vollendung des dritten Lebensjahres hinaus fortbesteht.
- Weiterführende Links:
» Persönliche Kinderbetreuung und Erwerbsobliegenheiten – Ab viertem Lebensjahr des Kindes
Abänderungsklage durch Unterhaltspflichtigen:
Ändern sich die für die Höhe ausschlaggebenden Umstände, muss der unterhaltspflichtige Elternteil, wenn der Unterhaltsberechtigte nicht auf einen früheren Titel verzichtet, Abänderungsklage erheben. Der Unterhaltsschuldner kann dann vortragen, dass eine Fortdauer des Betreuungsunterhalts nicht mehr der Billigkeit entspreche.
Weil die ursprüngliche Entscheidung zum Betreuungsunterhalt oft noch keine Prognose für Grund und Umfang einer weiteren Betreuungsbedürftigkeit enthält, obliegt die Darlegungs- und Beweislast für kind- und elternbezogene Gründe dann auch im Abänderungsverfahren dem betreuenden Elternteil. Nur wenn in dem abzuändernden Urteil schon konkrete Umstände für eine Fortdauer des Betreuungsunterhalts festgestellt waren, obliegt es dem Abänderungskläger, darzulegen und zu beweisen, dass diese Gründe nunmehr entfallen sind.
Begrenzung nach § 1611 Abs.1 BGB
§ 1615l Abs.3 BGB verweist auf die Vorschriften zum Verwandtenunterhalt und u.a. auf § 1611 Abs.1 BGB. Gemäß § 1611 Abs. 1 S. 1 BGB braucht der Verpflichtete nur einen Beitrag zum Unterhalt in der Höhe zu leisten, die der Billigkeit entspricht, wenn der Unterhaltsberechtigte durch sein sittliches Verschulden bedürftig geworden ist, er seine eigene Unterhaltspflicht gegenüber dem Unterhaltspflichtigen gröblich vernachlässigt oder sich vorsätzlich einer schweren Verfehlung gegen den Unterhaltspflichtigen oder einen nahen Angehörigen des Unterhaltspflichtigen schuldig gemacht hat.
Die Verpflichtung zur Leistung von Unterhalt entfällt gemäß § 1611 Abs. 1 S. 2 BGB in Gänze, wenn die Inanspruchnahme des Verpflichteten grob unbillig wäre. § 1611 BGB ist eine eng auszulegende Ausnahmevorschrift (BGH, Urteil vom 15. September 2010 – XII ZR 148/09, juris Rn. 37 = NJW 2010, 3714). Die Darlegungs- und Beweislast trifft den Unterhaltsschuldner, der sich auf die Verwirkung des Unterhalts durch den Unterhaltsgläubiger beruft (OLG Celle, Beschluss vom 19. August 2014 – 10 UF 186/14, juris Rn. 18 = FamRZ 2015, 71; Klinkhammer, in: Wendl/Dose, Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis, 9. Auflage 2015, § 2 Rn. 608).
Neuer Lebenspartner – Eheschließung
- Eine neue Lebenspartnerschaft des kinderbetreuenden Elternteils ist kein Erlöschensgrund, wie etwa beim Ehegattenunterhalt (§ 1579 Ziff.2 BGB). Ein Unterhaltsanspruch der nichtehelichen Mutter gegenüber dem Kindesvater ist nicht zwangsläufig verwirkt nach § 1611 Abs.1 BGB, wenn die Mutter mit einem neuen Lebenspartner in fester Beziehung lebt (OLG Frankfurt a.M., Beschluss vom 03.05.2019 – 2 UF 273/17).
Ansprüche nach § 1615l BGB beruhen ausdrücklich nicht auf einer (nach-) ehelichen Solidarität zwischen den beteiligten Elternteilen, sondern alleine auf dem Umstand, dass der Unterhalt des ein gemeinsames Kind betreuenden Elternteils gesichert sein soll. Im Eingehen einer neuen Partnerschaft liegt daher gerade keine Abkehr von der nur in der Ehe geschuldeten und durch § 1579 BGB sanktionierten Solidarität (OLG Frankfurt a.M, Beschluss vom 02.11.2016 – 6 UF 73/16). - Nur im Fall einer Eheschließung wird § 1586 BGB analog angewendet.
Selbst verschuldete Schwangerschaft?

OLG Frankfurt a.M., Beschluss vom 02.11.2016 – 6 UF 73/16
Keine Verwirkung wegen Schwangerschaft
Aus Entscheidungsgründen:
(Zitat, Rn 70) “V orliegend kann eine Verwirkung nicht darin gesehen werden, dass die Antragstellerin zu 2) überhaupt schwanger und damit unterhaltsbedürftig geworden ist, § 1611 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB. Zum einen erscheint es bereits fragwürdig, das Zulassen einer Schwangerschaft als sittliches Verschulden anzusehen, selbst wenn der Eintritt der Schwangerschaft als solcher – was zwischen den Beteiligten allerdings bis zuletzt streitig geblieben ist – nur dem Wunsch eines der Elternteile entspricht.
Zum anderen beruht die Schwangerschaft auf dem Verhalten beider Beteiligten, denen als Erwachsenen beiden bewusst ist, dass bei ungeschütztem Verkehr eine Schwangerschaft eintreten kann.”
Umgangsvereitelung
Will man in einem Umgangsboykott eine “schwere Verfehlung” nach § 1611 S. 1 BGB bejahen, ist dies nur unter engen, der vergleichbaren Regelung in § 1579 Nr. 7 BGB entsprechenden Voraussetzungen möglich. Erforderlich wäre, dass der Unterhaltsberechtigte den Umgang des pflichtigen Elternteils mit einem gemeinschaftlichen Kind fortgesetzt und massiv vereitelt.
Es muss sich um ein schwerwiegendes, eindeutig beim Berechtigten liegendes Fehlverhalten handeln (vgl. zum nachehelichen Unterhalt: BGH, Urteil vom 14.03.2007 – XII 158/04; OLG Nürnberg, Beschluss vom 08.04.1994 – 11 UF 2641/93). Soweit der Umgang nur zögerlich und nur im begleiteten Rahmen zugelassen wird, muss dargelegt werden, dass hierfür keine unterhaltsrechtlich zu akzeptierende Gründe bestehen. Die Umgangsvereitelung muss sich als schwerwiegende Verfehlung darstellen.
- Weiterführende Links:
» Begrenzung des Ehegattenunterhalts wegen Umgangsvereitelung
Unterhaltsverzicht – Verbot des § 1614 Abs.1 BGB
In § 1615l Absatz 3 S. 1 BGB wird angeordnet, dass auf den Betreuungsunterhalt die Vorschriften über den Verwandtenunterhalt entsprechend anzuwenden sind. § 1615I Abs. 3 S. 1 enthält insoweit eine Rechtsgrundverweisung (BGH, Beschluss vom 2.10.2013 – XII ZB 249/12) u.a. auf § 1614 Absatz 1 BGB. Danach kann auf Betreuungsunterhalt für die Zukunft nicht verzichtet werden (OLG Celle , Beschluss vom 20.12.2013 – 12 UF 157/13).
- Weiterführende Links:
» mögliche Unterhaltsvereinbarungen
» Möglichkeiten zum Unterhaltsverzicht
Tod der Unterhaltspflichtigen | § 1615 l Abs. 3 Satz 4 BGB
Der Anspruch auf Betreuungsunterhalt erlischt nicht mit dem Tod des unterhaltspflichtigen Vaters, der nach der Geburt des betreuungsbedürftigen Kindes verstirbt. Der BGH hatte sich damit auseinanderzusetzen, wie der Betreuungsunterhaltsbedarf und der Anspruch gegenüber den Erben zu ermitteln ist.

BGH, Beschluss vom 15.05.2019 – XII ZB 357/18
Bedarfsermittlung im Todesfall des Unterhaltspflichtigen
Anmerkung:
Hier entscheidet der BGH, im Fall des Todes des Unterhaltspflichtigen auch die den Erblasser (zu Lebzeiten) treffende Pflicht zur Zahlung von Ehegattenunterhalt im Rahmen der Halbteilung bereits auf der Bedarfsebene zu beachten ist. Dies war bisher eine ungeklärte Rechtsfrage.
Es ist folgerichtig, auch die den Erblasser (zu Lebzeiten) treffende Pflicht zur Zahlung von Ehegattenunterhalt im Rahmen der Halbteilung bereits auf der Bedarfsebene zu beachten (OLG Brandenburg, Beschluss vom 23.Oktober 2014 – 15 UF 109/12 – juris Rn 45; Wendl/Bömelburg, Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis, 9.Aufl., § 7 Rn120; NK-BGB/Schilling, 3.Aufl., §1615l Rn 41).
- Weiterführende Links:
» Tod des Unterhaltspflichtigen
Anspruchskonkurrenzen wegen mehrerer Unterhaltsschuldner
Für den kinderbetreuenden Elternteil (meist die Mutter) stellt sich die Frage, wer dafür aufzukommen hat, dass der eigene Unterhaltsbedarf wegen erwerbsmindernder Kinderbetreuung nicht mit eigenem Einkommen gedeckt werden kann. Neben dem nach § 1615l Abs.2 BGB unterhaltspflichtigen Kindesvater stehen als weitere (mögliche) Unterhaltspflichtige zur „Auswahl“
- die Verwandten der Mutter (Konkurrenz zum Verwandtenunterhalt) und womöglich
- der Ehemann der Mutter, der nicht zugleich der Vater des Kindes ist, wegen § 1360 BGB (Konkurrenz zum Familienunterhalt).
Konkurrenzverhältnis zum Verwandtenunterhalt – Unterhaltsanspruch gegen die Eltern
Hier ist die Rechtslage wegen § 1615l Abs. 3 S.2 BGB eindeutig: Die Verpflichtung des Vaters gegenüber der kinderbetreuenden Mutter geht der Verpflichtung der Eltern der Mutter vor.
Konkurrenzverhältnis zum Familienunterhalt – Unterhaltsanspruch gegen Ehemann
Wenn die Mutter nicht mit dem Vater des Kindes, sondern mit einem anderen Mann verheiratet ist oder einen anderen Mann heiraten wird, ist die Rechtslage nicht eindeutig: Es fehlt eine gesetzliche Regelung zur Frage des Konkurrenzverhältnisses zwischen Betreuungsunterhalt nach § 1615l BGB und dem Familienunterhalt nach § 1360 BGB.
- Ist die Mutter verheiratet („Seitensprung“)
so führt dies nach OLG Stuttgart zu einer anteiligen Haftung der Männer (Kindesvater und Ehemann) für den Unterhaltsbedarf der Mutter. - Wenn die Mutter später heiratet,
dann führt die spätere Heirat wegen analoger Anwendung des § 1586 Abs.1 BGB zum Erlöschen des Betreuungsunterhalts nach § 1615l Abs.2 BGB.;

OLG Stuttgart, Beschluss vom 14.12.2015 – 18 UF 123/15
Konkurrenz von Betreuungsunterhalt nach 1615l BGB zum Familienunterhalt
Sachverhalt:
Die unterhaltsberechtigte Mutter eines Kindes aus einer außerehelichen Beziehung ist verheiratet. Sie gab für die Kinderbetreuung für die ersten zwei Jahre nach der Geburt des Kindes ihre Erwerbstätigkeit auf. Den Erzeuger des Kindes will sie auf Betreuungsunterhalt nach § 1615l BGB in Anspruch nehmen. Der Vater des Kindes wendet dagegen ein, dass der Anspruch der Mutter auf Familienunterhalt gegen ihren Ehemann vorrangig sei (?) und daraus ihren Unterhaltsbedarf zu decken habe.
Das OLG Stuttgart räumt jedoch dem Familienunterhalt keinen Vorrang gegenüber dem Anspruch nach § 1615l BGB ein. Beide Unterhaltsansprüche der Mutter (zum einen gegen den Vater des Kindes, zum anderen gegen den Ehemann) bestehen gleichrangig. Somit ergibt sich im Ergebnis eine anteilige Unterhaltshaftung der Männer gegenüber der kinderbetreuenden Mutter.
(Zitat, Rn 13) „Ein Rangverhältnis der Unterhaltsansprüche in der Form, dass der Anspruch gegen den Ehemann gemäß § 1360 BGB der stärkere ist und der gegen den nichtehelichen Vater gemäß § 1615 Absatz I BGB dahinter zurücktritt, gibt es nicht. Vielmehr wird in Anlehnung an die Rechtsprechung des BGH zur anteiligen Haftung analog § 1606 Absatz 3 Satz 1 BGB bei konkurrierenden Betreuungsunterhaltsansprüchen der Mutter ehelicher und nichtehelicher Kinder gegen den getrennt lebenden Ehemann einerseits und den nichtehelichen Vater andererseits. (BGH FamRZ 1998, 541) von einem Grundsatz gleichrangiger Unterhaltspflicht ausgegangen (KG NZFam 2015, 721; BGH FamRZ 2008, 1739).“
Hinweis:
Betreut ein Elternteil neben dem nichtehelichen Kind auch eines aus einer – geschiedenen – Ehe, stehen der Anspruch aus § 1570 BGB gegen den Ehemann und derjenige aus § 1615 l BGB gegen den Erzeuger des Kindes nach der Rechtsprechung des BGH (NJW 1998, 1309) ebenfalls gleichberechtigt nebeneinander. Beide Unterhaltspflichtigen haften anteilig, allerdings nicht allein nach ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Zu berücksichtigen ist auch der Betreuungsaufwand, sodass der Vater des jüngeren Kindes zu erhöhtem Unterhalt verpflichtet sein kann.

BGH, Urteil vom 16.03.2016 – XII ZR 148/14
Kompensation des Anspruchs auf Betreuungsunterhalt durch Anspruch auf Familienunterhalt
Sachverhalt:
die Mutter eines nichtehelichen Kindes hat geheiratet und wollte nun wissen, ob der Betreuungsunterhalt gegen den Vater des Kindes nach § 1615l Abs.2 BGB fortbesteht oder wegen Heirat wegfällt. Der BGH geht davon aus, dass der Betreuungsunterhalt entfällt und begründet den Wegfall mit analoger Anwendung des § 1586 BGB.
Entscheidungsgründe:
(Zitat, Rn 16) „Nach der Rechtsprechung des Senats erlischt der Unterhaltsanspruch gemäß § 1615 l Abs. 2 Satz 2 BGB analog § 1586 BGB mit der Verheiratung des unterhaltsberechtigten Elternteils. Der Senat hat dies damit begründet, dass das Gesetz für den Unterhaltsanspruch nach § 1615 l BGB im Gegensatz zum nachehelichen Unterhaltsanspruch nach § 1570 BGB keine ausdrückliche Regelung enthält, wie zu verfahren ist, wenn die unterhaltsberechtigte Mutter einen anderen Mann als den Vater ihres Kindes heiratet, und hat darin eine unbewusste Regelungslücke gesehen.
Wenn der Gesetzgeber trotz der großen Nähe zu dem Anspruch aus § 1570 BGB von einer dem § 1586 Abs. 1 BGB entsprechenden Regelung abgesehen, dessen Anwendung aber auch nicht ausgeschlossen hat, kann das nur auf einer unbeabsichtigten Regelungslücke beruhen. Daher ist schon zur Gleichbehandlung einer geschiedenen Mutter mit der Mutter eines nichtehelichen Kindes im Fall der (Wieder-)Heirat eine entsprechende Anwendung von § 1586 BGB geboten (Senatsurteil BGHZ 161, 124 = FamRZ 2005, 347, 349 f.)”
Konkurrenzverhältnis zum nachehelichen Unterhalt – Unterhaltsanspruch gegen Ex-Ehemann

BGH, Urteil vom 16.07.2008 – XII ZR 109/05
Konkurrenz und anteiligen Haftung bei Betreuungsunterhalt und nachehelichen Unterhalt
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat, Tz 45): „Steht einem geschiedenen Ehegatten wegen der Betreuung eines ehelichen Kindes ein Anspruch auf Betreuungsunterhalt (§ 1570 BGB) zu und geht im Anschluss daran aus einer nichtehelichen Beziehung ein weiteres Kind hervor, haftet der andere Elternteil des später nichtehelich geborenen Kindes (§ 1615l II BGB) nach ständiger Rechtsprechung des Senats anteilig neben dem geschiedenen Ehegatten.“
- Weiterführende Links:
» Themengutachten, DIJuF-Rechtsgutachten 2015 mit Berechnungsbeispielen
» Begrenzung des nachehelichen Unterhalts wegen neuer verfestigter Lebensgemeinschaft
Anspruchskonkurrenzen wegen mehrerer Unterhaltsberechtigter

OLG Hamm, Beschluss vom 8.8.2013 – 6 UF 25/13
Zur Berechnung des Ehegattenunterhalts bei Konkurrenz mit Betreuungsunterhalt gemäß § 1615 I BGB
Bedarfsermittlung beim Ehegattenunterhalt:
Maßgebender Zeitpunkt für die Bedarfsbestimmung des Ehegatten ist der aktuelle Stand der wirtschaftlichen Verhältnisse, an deren Entwicklung die Ehegatten bis zur Scheidung teilnehmen (Wandel der ehelichen Lebensverhältnisse). Nach der neueren Rechtsprechung des BGH, die nach dem Beschluss des BVerfG vom 25.1.2011 (BVerfGE 128, 193 = NJW 2011, 836) ergangen ist, sind bei der Bedarfsberechnung grundsätzlich alle Veränderungen zu berücksichtigen, die bis zur Rechtskraft der Scheidung eintreten.
| Betreuungsunterhalt als Abzugsposten vom unterhaltsrelevanten Einkommen?
Ehegattenunterhalt neben Kinderbetreuungsunterhalt:
Der Bedarf an Ehegattenunterhalt (auch Trennungsunterhalt) wird bei Gleichrang (§ 1609 Nr.2 BGB) mit dem Betreuungsunterhaltsanspruch der Mutter des nichtehelichen Kindes nach der sog. Drittelberechnung bestimmt.
Wenn man auf den Wortlaut des § 1609 BGB mit seiner Anknüpfung an den Unterhalt wegen Kindesbetreuung abstellt, könnte der Trennungsunterhalt in einen Teil zerlegt werden, der auf den Unterhalt wegen Kindesbetreuung entfällt (Rang 2) und einen Teil, der auf eine Aufstockung nach Halbteilungsgrundsatz entfällt (Rang 3) (Kombination: Betreuungsunterhalt | Aufstockungsunterhalt).
Einer solchen gedanklichen Aufteilung des Ehegattenunterhalts für die Rangbestimmung erteilt der BGH eine Absage (BGH, Beschluss vom 1.10.2014 – XII ZB 185/13: Besteht ein Teilunterhaltsanspruch auf Betreuungsunterhalt und ein weiterer Teilanspruch aufgrund eines anderen Unterhaltstatbestands, unterfällt der Gesamtanspruch dem Rang des § 1609 Nr. 2 BGB).
Formel zur Drittelberechnung:
Bedarf pro Ehegatte = ([Einkommen Ehemann] + [Einkommen Ehefrau] + [Einkommen der Mutter des nichtehelichen Kindes]) x 1/3.
Anmerkung: Die Drittelberechnung zur Bedarfsermittlung gilt, wenn das nichteheliche Kind vor Rechtskraft der Scheidung geboren wurde (BGHZ 192, 45 = NJW 2012, 384 = FamRZ 2012, 281; OLG Hamm, Beschl. v. 8.8.2013 – 6 UF 25/13).
Berechnungsbeispiele bei Wendl/Dose, das Unterhaltsrecht in der familiengerichtlichen Praxis, § 1, Rn 1128).
Verfahren zur Durchsetzung des Betreuungsunterhalts

Antragsschrift
zum Betreuungsunterhalt für Kinder ab dem 3. Lebensjahr

BGH, Urteil vom 01.06.2011 – XII ZR 45/09
Darlegungs- und Beweislast des kinderbetreuenden Elternteils
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat, Rn 17): “Kind- oder elternbezogene Umstände, die aus Gründen der Billigkeit zu einer Verlängerung des Betreuungsunterhalts über die Vollendung des dritten Lebensjahrs hinaus führen könnten, sind deswegen vom Unterhaltsberechtigten darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen“.
FAQ zum Betreuungsunterhalt
Wer hat Anspruch auf Unterhalt nach der Geburt eines Kindes?
Nach der Geburt eines Kindes hat der betreuende Elternteil Anspruch auf Betreuungsunterhalt, wenn er aufgrund der Kindesbetreuung nicht oder nur eingeschränkt erwerbstätig sein kann. Zudem steht dem Kind Kindesunterhalt zu.
Wie lange besteht der Anspruch auf Betreuungsunterhalt?
Grundsätzlich besteht der Anspruch auf Betreuungsunterhalt für mindestens drei Jahre nach der Geburt. In bestimmten Fällen kann dieser verlängert werden, etwa wenn eine Erwerbstätigkeit wegen der Kindesbetreuung nicht zumutbar ist.
Wovon hängt eine Verlängerung des Anspruchs ab?
Eine Verlängerung über die drei Jahre hinaus hängt davon ab, ob es dem betreuenden Elternteil zugemutet werden kann, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Faktoren sind:
Das Alter des Kindes
Betreuungsmöglichkeiten (z. B. Kita, Tagesmutter)
Besondere Bedürfnisse des Kindes (z. B. gesundheitliche Probleme)
Finanzielle und berufliche Situation des betreuenden Elternteils
Wie hoch ist der Betreuungsunterhalt?
Die Höhe richtet sich nach dem Einkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils und dem Lebensstandard vor der Geburt. Die Berechnung ähnelt der des Ehegattenunterhalts.
Gilt der Anspruch auch für Väter?
Ja, unter bestimmten Umständen kann auch ein unverheirateter Vater Betreuungsunterhalt nach § 1615 l BGB verlangen, wenn er die Hauptbetreuung des Kindes übernimmt.
Kann der Anspruch auf Betreuungsunterhalt nachträglich geändert werden?
Ja, wenn sich die Lebensumstände (z. B. Einkommen, Betreuungssituation) wesentlich ändern, kann der Unterhalt angepasst oder beendet werden.

Diese FAQ´s bieten eine Grundlage für die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema Betreuungsunterhalt.
Für spezifische Fälle empfiehlt es sich, rechtliche Beratung einzuholen.
Links & Literatur
Links
Staatliche Leistungen für Alleinerziehende: Es gibt eine Vielzahl staatlicher Hilfen. Eine davon ist die Möglichkeit, nicht nur für den Kindesunterhalt, sondern auch für den Betreuungsunterhalt einen kostenlosen Unterhaltstitel über das Jugendamt (§ 59 Abs.1 Ziff.4 SGB VIII) erstellen zu lassen. – Quelle: BMFSFJ – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Betreuungsunterhalt – Checkliste zur Erwerbsobliegenheit
Literatur – Rechtsprechung
Birgit Niepmann, Der Unterhaltsanspruch des nichtehelichen Elternteils nach § 1615 l BGB, in: NZFam 2021, 395
LWL-Landesjugendamt Westfalen, Betreuungsunterhalt gem. § 1615l BGB, Stand Juni 2019
Hans-Ulrich Graba, Unterhaltsanspruch des Elternteils, der ein behindertes Kind betreut, in: NZFam 2019, 1025
Winfried Born, Betreuungsunterhalt – Was gibt es Neues?, in: FF 2015, 7 ff.
OLG Köln, Beschluss vom 21.02.2017 – 25 UF 149/16, Betreuungsunterhalt nach § 1615l BGB bei gehobenen Einkommensverhältnissen
In eigener Sache
AG Stuttgart – Antrag auf Betreuungsunterhalt , unser Az.: 43/24
Berechnung des Ehegattenunterhalts bei Konkurrenz mit Betreuungsunterhalt gemäß § 1615 I BGB, unser Az.: 83/22
AG Starnberg – 1 F 1040/21, Betreuungsunterhaltsanspruch gegen Unternehmer mit Vermögen, unser Az.: 95/21
AG München – 529 F 12210/20, Betreuungsunterhalt für Freiberufler, Auskunftsantrag zum Einkommen des Unterhaltspflichtigen, unser Az.: 72/20 (D3/836-20)
OLG Oldenburg – 13 UF 88/19, Begrenzung des Unterhaltsbedarfs nach Halbteilungsgrundsatz – Obliegenheit zur Vermögensverwertung des kinderbetreuenden Elternteils, unser Az.: 101/19 (D3/796-19)
AG Köln – 301 F 283/17 – Unterhaltsbedarf bei hohem Verdienstausfall und massivem Karriere-Knick (D3/101-18),
Darstellung des Karriere-Knicks wegen Kinderbetreuung, unser Az: 23/17 (D3/217-17)
Antrag auf Betreuungsunterhalt nach § 1615l BGB bei gehobenen Einkommensverhältnisses, unser Az: 23/17 (D3/400-17)
Erwerbsobliegenheit bei Betreuung eines Kindes im Kindergartenalter, unser Az.: 174/15 (D3/979-15)
Herabsetzung des Betreuungsunterhalts nach Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes, unser Az: 108/16 (D3/899-16)