- Dein Warenkorb ist leer.
Leistungsfähigkeit
und persönlicher Bedarf des Unterhaltspflichtigen
Standort:
Familienrecht > Scheidung München > Infothek > Unterhalt – Allgemeine Grundlagen > Prüfungsschema > Prüfungsebene IV – Leistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeit und Eigenbedarf des Unterhaltspflichtigen
Kann der Unterhaltspflichtige den Unterhalt leisten? –
Wie viel Einkommen muss dem Unterhaltspflichten für den eigenen Lebensbedarf bleiben?
Die Leistungsfähigkeit und der Eigenbedarf des Unterhaltspflichtigen sind zwei wichtige Faktoren bei der Berechnung von Unterhaltszahlungen. Dabei geht es darum, ob der Unterhaltspflichtige über ausreichend finanzielle Mittel verfügt, um den festgelegten Unterhalt zu leisten, und wie viel Einkommen ihm für seinen eigenen Lebensbedarf zusteht.
Um diese Fragen beantworten zu können, ist es wichtig zu verstehen, was unter Leistungsfähigkeit und Eigenbedarf verstanden wird.
Verstehen Sie die Grenzen der Leistungsfähigkeit!
Wie wird die Leistungsfähigkeit ermittelt und welche Korrekturen der vorgegebenen Selbstbehaltssätze sind im Einzelfall notwendig? Benötigen Sie Unterstützung? Rufen Sie uns an unter 089 / 2155-4181-0 und lassen Sie sich von unserer Expertise überzeugen. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Beratungstermin!
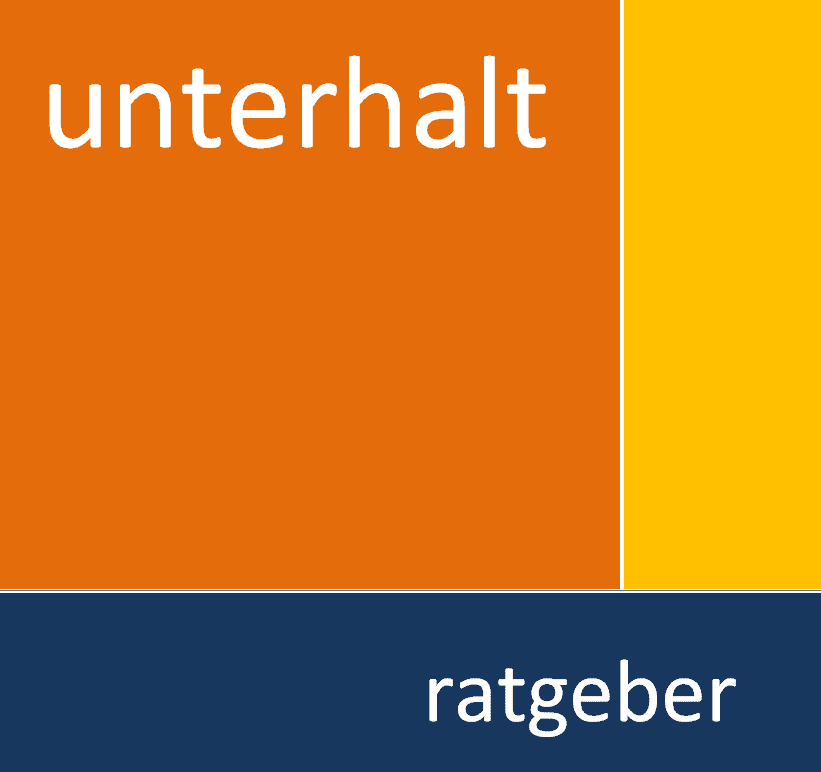
| Prüfungsebene IV- Wegweiser zur unterhaltsrechtlichen Leistungsfähigkeit
Das Wichtigste in Kürze
- Fragen zur Leistungsfähigkeit und Eigenbedarf des Unterhaltspflichtigen sind auf der vierten Prüfungsebene im Grundschema zum Unterhaltsnspruch zu stellen.
- Wer als Unterhaltsschuldner nach seinen Erwerbs- und Vermögensverhältnissen nur seinen eigenen angemessenen Unterhalt sichern kann (Eigenbedarf), ist wegen Leistungsunfähigkeit nicht unterhaltspflichtig (vgl. § 1603 Abs.1 BGB).
- Eine wichtige Frage ist, wie hoch der Eigenbedarf ist und wer ihn festlegt. Die gesetzlichen Vorschriften geben darauf keine Antwort. Stattdessen finden Sie die Antwort in Richtlinien und unterhaltsrechtlichen Leitlinien. Diese Richtlinien setzen Beträge für den Eigenbedarf fest, bekannt als Selbstbehaltssätze. Es gibt jedoch individuelle Umstände, die ein Abweichung von den Selbstbehaltsätzen rechtfertigen können.

Inhaltsverzeichnis | Prüfungsebene IV – Leistungsfähigkeit und Eigenbedarf
Gesetzliche Grundlagen
Leistungsfähigkeit beim Kindesunterhalt
§ 1603 BGB | Gesetzestext
(1) Unterhaltspflichtig ist nicht, wer bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande ist, ohne Gefährdung seines angemessenen Unterhalts den Unterhalt zu gewähren.
(2) Befinden sich Eltern in dieser Lage, so sind sie ihren minderjährigen unverheirateten Kindern gegenüber verpflichtet, alle verfügbaren Mittel zu ihrem und der Kinder Unterhalt gleichmäßig zu verwenden. Den minderjährigen unverheirateten Kindern stehen volljährige unverheiratete Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gleich, solange sie im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils leben und sich in der allgemeinen Schulausbildung befinden. Diese Verpflichtung tritt nicht ein, wenn ein anderer unterhaltspflichtiger Verwandter vorhanden ist; sie tritt auch nicht ein gegenüber einem Kind, dessen Unterhalt aus dem Stamme seines Vermögens bestritten werden kann.
- Weiterführende Links:
» Wegweiser zur Leistungsfähigkeit der Eltern
» Unterhalt für Kinder mit eigenem Vermögen
Leistungsfähigkeit beim nachehelichen Unterhalt
§ 1581 BGB | Gesetzestext
“Ist der Verpflichtete nach seinen Erwerbs- und Vermögensverhältnissen unter Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande, ohne Gefährdung des eigenen angemessenen Unterhalts dem Berechtigten Unterhalt zu gewähren, so braucht er nur insoweit Unterhalt zu leisten, als es mit Rücksicht auf die Bedürfnisse und die Erwerbs- und Vermögensverhältnisse der geschiedenen Ehegatten der Billigkeit entspricht.
Den Stamm des Vermögens braucht er nicht zu verwerten, soweit die Verwertung unwirtschaftlich oder unter Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse unbillig wäre.”

BGH, Beschluss vom 16.10.2019 – XII 341/17
Zur Bemessung des eheangemessenen Selbstbehalts
Anmerkung:
Die Ermittlung des Ehegattenunterhalt wird vom sog. Halbteilungsgrundsatz beherrscht: Danach stet jedem Ehegatten grundsätzlich die Hälfte des Gesamteinkommen der Ehegatten zu. Der Halbteilungsgrundsatz trifft damit eine wichtige Aussage zum Eigenbedarf des Ehegatten.
Die Selbstbehaltsätze der Düsseldorfer Tabelle zum Ehegattenunterhalt gewinnen damit nur an Bedeutung, wenn ein Ehegatte den Mindestunterhalt fordert und hier der unterhaltspflichtige Ehegatte an die Grenze der Leiustungsfähigkeit stößt.
- Weiterführende Links:
» Begrenzung des ehelichen Unterhaltsbedarfs nach Halbteilungsgrundsatz
» Leistungsfähigkeit des unterhaltspflichtigen Ehegatten
Leistungsfähigkeit beim Trennungsunterhalt
§ 1581 BGB entsprechend anwendbar

BGH, Urteil vom 17.08.2008 – XII ZR 63/07
Ehegattenselbstbehalt im Rahmen des Trennungsunterhalts
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat) “Für den Trennungsunterhalt fehlt zwar eine dem § 1581 BGB entsprechende Regelung, die den Selbstbehalt des unterhaltspflichtigen Ehegatten sicherstellt. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebietet es jedoch, diese Vorschrift entsprechend anzuwenden, da sich auch der Anspruch auf Trennungsunterhalt wie jeder Unterhaltsanspruch an der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen auszurichten hat (Senatsurteil BGHZ 166, 351, 358 = FamRZ 2006, 683, 684 m.w.N.).”
Anmerkung:
Die Vorschrift zum Trennungsunterhalt (§ 1361 BGB) enthält keine spezielle Regelung zur Leistungsfähigkeit. Es ist allgemein anerkannt, dass hier die gleichen Maßstäbe wie beim nachehelichen Unterhalt nach § 1581 BGB gelten.
Maßstäbe für Leistungsfähigkeit
Eigenbedarf: Der Selbstbehalt markiert die Grenze zur Leistungsunfähigkeit
Kann der Unterhaltsschuldner seinen eigenen Lebensunterhalt nicht sicherstellen, da er andere Verpflichtungen hat, besteht keine Unterhaltsverpflichtung aufgrund fehlender Leistungsfähigkeit. Es ist wichtig, den eigenen Bedarf vor anderen Unterhaltsverpflichtungen zu decken. Eigenbedarf bezieht sich auf den Teil des Einkommens, der dringend für den eigenen Lebensunterhalt benötigt wird. Doch wie viel Einkommen sollte dem Unterhaltspflichtigen dafür zur Verfügung stehen?
Die gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsfähigkeit legen keine genaue Höhe für den angemessenen Eigenbedarf fest. Ohne diese Kenntnis ist es schwierig zu beurteilen, wann die Grenze der Leistungsunfähigkeit erreicht ist. Diese Einschätzung kann von jeder Person unterschiedlich empfunden werden.
Leistungsfähigkeit und Selbstbehaltsätze

BGH, Urteil vom 19. Februar 2003 – XII ZR 67/00
Eigenbedarf – Unterhaltstabellen – Selbstbehaltssätze
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat) „Als angemessener Unterhalt müssen aber auch bei bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen diejenigen Mittel angesehen werden, durch die das Existenzminimum der Eltern sichergestellt werden kann und die demgemäß als Untergrenze des Bedarfs zu bewerten sind (…). Insofern ist es auch nicht rechtsfehlerhaft, wenn zur Ermittlung des so bemessenen Bedarfs auf die in den Unterhaltstabellen enthaltenen, am sozialhilferechtlichen Existenzminimum ausgerichteten Eigenbedarfssätze (…) zurückgegriffen (…) wird (…).“
Anmerkung:
Um willkürliche Meinungen zu vermeiden, bietet die Düsseldorfer Tabelle Richtlinien für den eigenen Regelbedarf in Form von Selbstbehaltssätzen. Diese wiederum werden in den OLG-Bezirken über unterhaltsrechtliche Leitlinien übernommen. Die Selbstbehaltssätze bestimmen somit die Grenze der Leistungsfähigkeit. Dabei handelt es sich um Richtwerte, die je nach individuellen Verhältnissen zu Korrekturen führen können.
Bei der individuellen Bemessung des Selbstbehalts, die nach ständiger Rechtsprechung des BGH grundsätzlich Aufgabe des Tatrichters ist, sind zusätzlich die gesetzlichen Vorgaben zu beachten, die sich insbesondere aus dem Wesen der Unterhaltspflicht ergeben (vgl. BGH FamRZ 2009, 307 Rn.23 mwN = NJW-RR 2009, 289).
- Weiterführende Links:
» Düsseldorfer Tabelle und Obergerichtliche Leitlinien – Hilfsmittel für den Durchschnittsfall
Selbstbehalt und Art des Unterhalts
Eine pauschale Grenze der Leistungsfähigkeit gibt es nicht. Weil die gesetzlichen Vorschriften zu den jeweiligen Unterhaltsarten unterschiedliche Anforderungen an die Leistungsbereitschaft des Unterhaltspflichtigen stellen, gelten je nach Unterhaltsart spezifische Selbstbehaltssätze. Der Selbstbehalt, bis zu dem das Einkommen des Unterhaltsschuldners nicht für Unterhaltsleistungen zur Verfügung steht, sind je nach Unterhaltspflicht unterschiedlich hoch.
- Weiterführende Links:
» Selbstbehalt für Eltern beim Kindesunterhalt
» Selbstbehalt des Ehegatten beim Ehegattenunterhalt
Bemessungsfaktoren der Leistungsfähigkeit
Formel der Leistungsfähigkeit
Leistungsfähig ist, wer Einkommen und verwertbares Vermögen über dem zu belassenden Eigenbedarf besitzt.
Fiktives Einkommen zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit
Die Formel zur Leistungsfähigkeit besagt, dass zunächst das unterhaltsrelevante Einkommen festzustellen ist. Die Einkommensermittlung zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit folgt anderen Regeln als bei der Bedarfsermittlung nach Maßgabe des Einkommens.
Auf der Ebene der Leistungsfähigkeit gewinnt die Obliegenheit zur Einkommensoptimierung erheblich an Bedeutung und führt zur möglichen Zurechnung von fiktivem Einkommen. Dahinter steckt die Idee, dass der Unterhaltspflichtige zur Abwehr von Unterhaltspflichten nicht lediglich auf sein (niedriges) Realeinkommen verweisen kann.
- Weiterführende Links:
» Einkommen als Bemessungsgrundlage für die Leistungsfähigkeit
Einkommensbereinigung und weitere Unterhaltspflichten
Treffen den Unterhaltspflichtigen mehrere Unterhaltspflichten gegenüber meheren Unterhaltsberechtigten, können vorrangige Unterhaltspflichten gem. § 1609 BGB Abzugsposition vom Einkommen zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit sein, um die Situation eines Mangelfalls lösen oder einen Haftungsanteil zu bestimmen.
Achtung:
Diese Form der Einkommensbereinigung gilt nicht zur Bestimmung des Unterhaltsbedarfs des jeweiligen Unterhaltsberechtigten. Nachrangige Unterhaltsberechtigte können aber die Bedarfsermittlung für vorrangige Unterhaltsberechtigte im Rahmen einer Angemessenheitsprüfung beeinflussen (vgl. Brudermüller, in Palandt, BGB, 74. Aufl., 2015, Rn 32 zu 1609 BGB).
- Weiterführende Links:
» Einkommensbereinigung – legale Abzugsposten
Unterhaltsrelevante Vermögen
Ist kein Einkommen vorhanden, das den Selbstbehalt übersteigt, ist nach der Obliegenheit zur Vermögensverwertung zum Erhalt der Leistungsfähigkeit zu fragen.
Einkommensschwankungen
und aktuelle Leistungsfähigkeit
Stets muss zunächst die Prüfungsebene „Bedarf“ zu einem möglichen Unterhaltsanspruch führen. Erst, wenn ein Unterhaltsbedarf festgestellt und die Bedürftigkeit des Unterhaltsberechtigten bejaht ist, wird anschließend die Leistungsfähigkeit geprüft. Diese Prüfungsreihenfolge zu beachten ist sehr wichtig, wenn Einkommensschwankungen bei der Unterhaltsermittlung zu berücksichtigen sind. Denn Einkommensschwankungen wirken sich auf den jeweiligen Prüfungsebenen sehr unterschiedlich aus. Wir können aus unserer Praxis berichten, dass in diesem Bereich von Anwälten und selbst von Familiengerichten häufig Fehler gemacht werden.
Bedarfsermittlung und Einkommensschwankungen
Kurzfristige und vorübergehende Einkommensschwankungen werden bei der Feststellung des Bedarfs nicht berücksichtigt. Bemessungsgrundlage auf der Bedarfsebene ist das in der Vergangenheit nachhaltig erzielte Einkommen, das zur Grundlage der Einkommensprognose für künftige Unterhaltsansprüche wird. Der Bedarfsmaßstab basiert nicht auf einer Aktualitäts-Betrachtung, sondern auf einer langfristig angelegten, sicher überschaubaren Zukunftsprognose, die kurzfristige und unvorhersehbare Einkommensschwankungen ausblendet.
Die Prüfungsebene „Bedarf“ ist also resistent gegen kurzfristige und außergewöhnliche Einkommensschwankungen. Nur wenn es zu einem sog. nachhaltigen Einkommensrückgang oder Einkommenssteigerung kommt, kann diese den ursprünglichen Bedarfsmaßstab beeinflussen (Beispiel: vorübergehende Arbeitslosigkeit oder dauerhafte Einkommenseinbuße).
Leistungsfähigkeit und Einkommensschwankungen
Anders als der Bedarfsmaßstab kann sich die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen von Monat zu Monat ändern. Bei Feststellung der Leistungsfähigkeit werden aktuelle, auch kurzfristige Einkommensänderungen berücksichtigt. Die ursprünglich angenommene Leistungsfähigkeit kann sich also spontan ändern, ohne dass sich der langfristig angelegte Bedarfsmaßstab ändert. Genau deshalb ist strikt zwischen der Prüfungsebene „Bedarf“ und Prüfungsebene „Leistungsfähigkeit“ zu unterscheiden.
Aus diesem Grund unterliegt die Ermittlung des unterhaltsrechtlichen Einkommens auf der Bedarfsebene anderen Regeln als auf der Ebene der Leistungsfähigkeit. Auf der Ebene der Leistungsfähigkeit gilt die Pflicht des Unterhaltspflichtigen, sich so weit wie möglich leistungsfähig zu halten (vgl. z.B. OLG Hamm, Beschluss vom 03.11.2010 – 8 UF 138/10).
- Weiterführende Links:
» Einkommensermittlung und Prüfungsebene
» Unterhalt abändern wegen Einkommensrückgang
Selbstbehaltssätze der Düsseldorfer Tabelle
Selbstbehaltssatz
und Erwerbstätigkeit
Die Selbstbehaltsätze differenzieren zwischen Eigenbedarf von erwerbstätigen und nicht erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen. Um einen gewissen Anreiz zur Erwerbstätigkeit oder Bonus für Erwerbstätige zu bieten, ist der Selbstbehaltssatz für Erwerbstätige höher. Im Einzelfall kann es hier zum Streit kommen, welcher Satz nun anzuwenden ist:

OLG Köln, Beschluss vom 29.6.2022 – 10 UF 10/22
Selbstbehalt bei Bezug von Krankengeld
Anmerkung:
Laut einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 19.11.2008 – XII ZR 129/06) wird beim Bezug von Krankengeld der Selbstbehalt eines Erwerbstätigen nicht berücksichtigt. Der erhöhte Selbstbehalt schafft einen Anreiz für Erwerbstätige, ihre Arbeitstätigkeit nicht aufzugeben, und ist Teil der Leistungsfähigkeit. Diese Rechtfertigung entfällt jedoch, wenn der Unterhaltspflichtige nicht erwerbstätig ist oder aufgrund von Krankengeld längere Zeit aus dem Erwerbsleben ausgeschieden ist.
Die Tatsache, dass das Krankengeld gemäß § 48 Abs.1 SGB V für dieselbe Krankheit nur zeitlich begrenzt gezahlt wird und gemäß § 50 Abs.1 Nr.1 SGB V nur bis zur krankheitsbedingten Verrentung, hat keinen Einfluss darauf. Ebenso ist die Tatsache, dass sich die Höhe des Krankengeldes am früheren Einkommen orientiert und eine Lohnersatzfunktion hat, nicht relevant.
Eigenbedarf der Eltern
Selbstbehaltssätze gegenüber ihren unterhaltsberechtigten Kindern
Notwendiger Eigenbedarf – § 1603 Abs.2 BGB:
Selbstbehaltssätze ggü. minderjährigen und privilegiert volljährigen Kindern
Der notwendige Selbstbehalt im Rahmen der Leistungsfähigkeit gem. § 1603 Abs.2 BGB stellt sich lt. Ziff. 5 der Anm. zur Düsseldorfer Tabelle im Jahr 2023 im Überblick wie folgt dar:
| 502 € | Sozialrechtlicher Regelbedarf: Existenzminimumsbericht |
| 50 € | Pauschale Erhöhung; rechnerisch exakt 48 € |
| 520 € | Wohnkosten, Warmmiete |
| 30 € | Ansatz für Versicherungen |
| 20 € | „Puffer“ |
Das ergibt in Summe 1.120 € für nicht erwerbstätige Eltern. Für den notwendigen Selbstbehalt von erwerbstätigen Eltern wird ein „Erwerbsanreiz“ von 250 € hinzuaddiert (= 1.370 € | 2023); vgl. Martin Menne, zu den Bausteinen der Düsseldorfer Tabelle, in: FF 2023, 12, 19. Ergebnis:
- falls erwerbstätig: 1.450 € (2025 und 2024) | 1.370 € (2023) | 1.160 € (2022)
- falls nicht erwerbstätig: 1.200 € (2025 und 2024) | 1.120 € (2023) | 960 € (2022)
- Hierin sind jeweils Kosten für Unterkunft und Heizung (Warmmiete) in Höhe von 520 € (2025) enthalten.
Anmerkung:
Der notwendige Selbstbehaltssatz lt. Düsseldorfer Tabelle markiert das dem unterhaltspflichtigen Elternteil belassene Existenzminimum, damit dieser aufgrund von Unterhaltslasten nicht selbst sozialhilfebedürftig wird. Mit dieser Absenkung des angemessenen Eigenbedarfs der Eltern nach § 1603 Abs.1 BGB auf das lediglich Notwendigste wird die gesetzliche Vorgabe des § 1603 Abs.2 BGB (sog. „gesteigerte“ Leistungsfähigkeit der Eltern für den Unterhalt für Minderjährige und Kinder i.S.d. § 1603 Abs.2 S.2 BGB) umgesetzt.
- Weiterführende Links:
» Notwendiger Selbstbehalt
» Unterhalt für Kinder – Leistungsfähigkeit der Eltern
Angemessener Eigenbedarf – § 1603 Abs.1 BGB:
Selbstbehaltsätze ggü. sonstige volljährige Kinder
- 1.750 € (2025 und 2024) | 1.650 € (2023) | 1.400 € (2022).
- Eine Differenzierung zwischen erwerbstätigen und nicht erwerbstätigen Eltern ist lt. Ziff. 5 der Anm. der Düsseldorfer Tabelle nicht vorgesehen.
- Hierin sind Kosten für Unterkunft und Heizung (Warmmiete) in Höhe von 650 € (2025) enthalten.
Anmerkung:
Der angemessene Selbstbehalt der Eltern markiert die Grenze, ab der der „eigene angemessene Unterhalt“ barunterhaltspflichtiger Eltern i.S.d. 1603 Abs.1 BGB in Gefahr gerät. Er gilt in allen Fällen, in denen die Vorschrift des § 1603 Abs.2 S.1 und S.2 BGB ausnahmsweise nicht greift.
- Weiterführende Links:
» Ausnahmen von der gesteigerten Leistungsfähigkeit nach § 1603 Abs.2 S.1 und S.2 BGB
» Unterhalt für Kinder – Leistungsfähigkeit der Eltern
Eigenbedarf des Ehegatten und beim Betreuungsunterhalts nach § 1615l BGB:
Selbstbehaltssätze gegenüber berechtigten Ehegatten und kinderbetreuenden Elternteil
- falls erwerbstätig: 1.600 € (2025 und 2024) | 1.510 € (2023) | 1.280 € (2022)
- falls nicht erwerbstätig: 1.475 € (2025 und 2024) | 1.385 € (2023) | 1.180 € (2022)
- Hierin sind jeweils Kosten für Unterkunft und Heizung (Warmmiete) in Höhe von 580,00 € (2025) enthalten.
Korrektur der Selbstbehaltssätze
Im angemessenen Selbstbehalt lt. Düsseldorfer Tabelle
einkalkulierte Bedarfspositionen
Wenn die Düsseldorfer Tabelle oder die Leitlinien der OLGs Regelsätze zum Selbstbehalt festlegen, bedeutet das normalerweise, dass von einer Person erwartet wird, ihren Lebensunterhalt mit dem angegebenen Geldbetrag aus dem Selbstbehalt zu bestreiten. Die Selbstbehaltsätze basieren auf Berechnungsgrundlagen für den Durchschnittsfall und werden anhand des Existenzminimumberichts der Bundesregierung ermittelt. Die darin enthaltenen essenziellen Bedarfspositionen sind in § 20 Abs.1 SGB II und § 27a Abs.1 SGB XII aufgeführt. Diese umfassen im Wesentlichen folgende Bedarfspositionen:
- Bekleidung
- Wohnraum – Miete
- Energielieferung
- Heizung
- Nahrung
- Pflegemittel
- Kraftfahrzeuge
- Zeitung
- Telefon
- Fernsehen
- Rundfunk
- Computeranschluss
Die Aufzählung dieser Bedarfspositionen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können im individuellen Einzelfall Korrekturen veranlassen.
Anlässe für Korrekturen
der Selbstbehalt-Bedarfspositionen
Die Selbstbehaltsätze gehen davon aus, dass der Unterhaltsschuldner zur Miete wohnt, keinen gemeinsamen Haushalt mit einem Lebenspartner hat und nicht wieder verheiratet ist . Sobald das nicht mehr gegeben ist, stimmt die Kalkulationsgrundlage für den Standard-Selbstbehalt der Düsseldorfer Tabelle nicht mehr; Eine Herabsetzung des Selbstbehaltsatzes ist angezeigt und durchzuführen. Folgende Fall-Situationen sind in der Praxis typisch, um die standartisierten Selbstbehaltsätze im Einzelfall zu korrigieren und modifiziert anzuwenden.
- Hohe Wohn- und Mietkosten
in teuern Ballungszentren - Patchwork
(neuer) Lebenspartner deckt den Eigenbedarf? - Synergieeffekte
Spareffekte, welche den Selbstbehalt mindern. - Wohnvorteil
Mietfreies Wohnen & Selbstbehalt
Korrektur einkalkulierter Wohnkosten
Die Selbstbehaltssätze der Düsseldorfer Tabelle haben zur Festlegung des notwendigen und angemessenen Eigenbedarfs des Unterhaltspflichtigen die erforderlichen Kosten für Unterkunft einschließlich umlagefähiger Kosten für Heizung (Warmmiete) gesondert ausgewiesen.
Im Jahr 2023 wurden die Wohnkostenansätze im Selbstbehalt deutlich erhöht. Die Wohnkosten stellen seit Jahren bereits das „Sorgenkind“ der Düsseldorfer Tabelle dar: Denn unter den verschiedenen Einzelpositionen des Selbstbehalts stellen sie nach wie vor die bedeutsamste und einzige variable Größe dar, die sich zudem nicht sachgerecht pauschalieren lässt (Menne, FF 2023, 12, 18).
Tatsächlich variieren die Kosten der Unterkunft im bundesweiten Vergleich unverändert extrem stark: Gerade im Ballungszentren stimmt der Wohnbedarfssatz nicht mit der Realität der Wohnkosten überein. Die Selbstbehaltsätze bauen auf der Grundvorstellung auf, dass der Unterhaltspflichtige allein zur Miete wohnt. Dies gibt Anlass, an die Erhöhung des Selbstbehaltssatzes, angepasst an die Mietkosten, zu denken.
Wann ist eine Korrektur des Selbstbehaltssatzes wegen hoher Mietkosten veranlasst?
Korrekturen sind nur zulässig und veranlasst, wenn aufgrund hoher Mietkosten eine Mangelfallberechnung angezeigt ist.

OLG Saarbrücken, Beschluss vom 23.02.2021 – 6 UF 160/20
Erhöhter Mietaufwand des Unterhaltspflichtigen | Mangelfall droht
Leitsatz:
Erhöhter Mietaufwand des Unterhaltsverpflichteten (hier: in Frankfurt) rechtfertigt keine Kürzung des unterhaltsrechtlichen Einkommens. Der Wohnkostenanteil, der in die Selbstbehaltssätze der Düsseldorfer Tabelle eingearbeitet ist, ist lediglich im Mangelfall von Bedeutung; ansonsten ist der Mietaufwand allgemeiner Lebensbedarf, den der Unterhaltspflichtige aus den ihm nach Unterhaltszahlung verbleibenden Einkünften zu bestreiten hat.
Obliegenheit zur Reduzierung der Wohnkosten
Der Selbstbehalt soll erhöht werden, wenn die Wohnkosten (Warmmiete) den ausgewiesenen Betrag übersteigen und nicht unangemessen sind. Dies ist auch in der höchstrichterlichen Rechtsprechung verankert. Danach kann im Einzelfall eine Erhöhung des Selbstbehalts nur infrage kommen, wenn der darin enthaltene Wohnkostenanteil – nach den Umständen nicht vermeidbar – überschritten wird (BGH, Beschluss vom 9.3.2016 – XII ZB 693/14, m. Anm. Seiler = FF 2016, 254 m. Anm. Engels).
Soweit die Beantragung von Wohngeld möglich ist, etwa ab Ende des Bezugs von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II (vgl. § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WoGG) trifft den Unterhaltspflichtigen die Obliegenheit, sich ihm mögliche und zumutbare Einkommensquellen zu erschließen, was in erhöhtem Maße im Mangelfall gilt (zur Obliegenheit Wohngeld zu beantragen vgl. BGH, Beschluss vom 28.10.2020 – XII ZB 512/19, Rn 18).Da es insoweit um die Frage der eingeschränkten Leistungsfähigkeit im Sinne des § 1603 BGB geht, hat der Unterhaltsschuldner mit erhöhten Wohnkosten darzulegen und zu beweisen, dass er dieser Obliegenheit nachgekommen ist (vgl. Wendl/Dose/ Klinkhammer, Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis 10. Aufl. § 2 Rn. 392).
Wer hier zum Erfolg kommen will, muss nachweisen, welchen Mietzins er tatsächlich zahlt (mit Mietvertrag und Zahlungsbelegen) und sich erfolglos um billigeren Wohnraum bemüht hat (OLG Frankfurt a.M., Beschluss vom 09.05.2019 – 5 UF 141/17 – intern vorhanden zu Az.: 9/16).
Anteilige Berücksichtigung der Wohnkosten
Fallen Wohnkosten nicht nur für den Unterhaltspflichtigen an, sondern decken diese auch den Wohnbedarf seiner weiteren Familienmitglieder (Ehefrau und Kinder), werden beim Kindesunterhalt die vom Unterhaltspflichtigen für den Familienverband getragenen Wohnkosten nur anteilig berücksichtigt (BGH, Beschluss vom 28.10.2020 – XII ZB 512/19; Wendl/Dose/ Gerhardt, Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis, 10. Aufl. § 1 Rn. 469; Wendl/Dose/Guhling, Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis, 10. Aufl. § 5 Rn. 27).
- Weiterführende Links & Literatur:
» Mietkosten und Mietwohnung der Ehegatten im Unterhaltsrecht
» Gerhardt, eigene Mietkosten, in: Wendl/Dose, Das Unterhaltsrecht in der familienrechtlichen Praxis, 9. Aufl 2015, § 1, Rn 468 ff.
Mehrere Unterhaltsberechtigte
und Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen
Verteilungsmasse
unter den Unterhaltsberechtigten aufteilen
Kann der Unterhaltsschuldner unter Berücksichtigung seines Eigenbedarfs nicht alle Unterhaltsansprüche mehrerer Unterhaltsgläubiger vollständig erfüllen (Mangelfall), so zeigt sich ein rechtlich zu lösender Verteilungskampf: Wer bekommt ein Stück vom Kuchen? Irgendwann wird die wirtschaftliche Situation erreicht, in der nicht mehr alle Unterhaltsberechtigten den vollen Unterhalt erhalten können, weil dazu ausreichend Geld über der Schwelle zum Selbstbehalt fehlt. Das kann dazu führen, dass vorrangige Unterhaltsberechtigte etwas von der vorhandenen Verteilungsmasse erhalten und nachrangige Unterhaltsberechtigte leer ausgehen.
Heinrich Schürmann (Unterhalt – Entscheidungen zwischen Not und Elend, in: FamRZ 2022, 1009) äußert sich anhand der Düsseldorfer Tabelle 2022 zum Mangelfall, der in den ersten beiden Einkommensgruppen fast schon zum Regelfall wird (Zitat): „Bei der unterstellten Familienkonstellation mit zwei Unterhaltsberechtigten genügt der Eingangsbetrag von 1.900 Euro schon heute nicht mehr, um den Unterhalt für zwei ältere Kinder unter Wahrung des notwendigen Selbstbehalts aufzubringen.
Es wären noch weit mehr Fallgestaltungen, wenn der notwendige Selbstbehalt nicht nochmals bei 1.160 Euro eingefroren worden wäre, sondern der sich bereits im Herbst letzten Jahres abzeichnenden Preissteigerung angemessen Rechnung getragen hätte. Nun ist die Absenkung auf den notwendigen Selbstbehalt die auf den Mangelfall begrenzte Ausnahme – als Regelfall kann ein Unterhaltspflichtiger auch im Verhältnis zu seinen minderjährigen Kindern die Wahrung seiner angemessenen Lebensverhältnisse behaupten (§ 1603 Abs. 1 BGB).
Gegenwärtig bedarf es eines bereinigten Nettoeinkommens zwischen 1.980 und 2.250 Euro, damit der Mindestbedarf für zwei Kinder aufgebracht werden kann. Mit anderen Worten: Der auf den Unterhalt für zwei Kinder ausgelegte Bezugsrahmen postuliert in der zweiten Einkommensgruppe einen Bedarf, der in einen Mangelfall führt und damit in jedem Fall zu korrigieren ist.”
Mangelfall
Erster Schritt
Bedarfsermittlung:
Um einen Mangelfall erstmal festzustellen, ist für alle Unterhaltsberechtigten der Unterhalt nach den üblichen Bedarfsermittlungsmethoden durchzuführen.
- Kindesunterhalt:
Bei der Bedarfsermittlung des Kindesunterhalts mithilfe der Düsseldorfer Tabelle werden (unabhängig vom Rang) alle vorhandenen Unterhaltsberechtigten berücksichtigt, indem eine Herabstufung bei Anwendung der Einkommensgruppen stattfinden. So kann der volle Bedarf vorrangiger Unterhaltsberechtigter bis hin zum verbleibenden Mindestbedarf gekürzt werden (Gerhardt, FuR 2010, 241; Berechnungsbeispiel mit minderjährigen Kindern, Ehegattenunterhalt und nachrangigen Volljährigen, Gerhardt in: Hdb. des FamR, 9. Aufl., 6. Kap. Rn 754, Fall 8).
Die Mangelfallberechnung mit vor- und nachrangigen Unterhaltsberechtigten ist hoch kompliziert und soll hier im Detail nicht dargestellt werden (Berechnungsbeispiel mit minderjährigen Kindern, Ehegattenunterhalt und nachrangigen Volljährigen, Gerhardt in: Hdb. des FamR, 9. Aufl., 6. Kap. Rn 754, Fall 8). - Ehegattenunterhalt:
Bei der Bedarfsermittlung zum Ehegattenunterhalt wird das Einkommen der Ehegatten um sämtliche Kindesunterhaltsansprüche (ob vor- oder nachrangig) bereinigt.
Ist nach Ermittlung des Bedarfs und der Bedürftigkeit aller Unterhaltsberechtigter festzustellen, dass die Verteilungsmasse des Unterhaltspflichtigen zur Erfüllung aller Unterhaltspflichten nicht ausreicht, ist ein Mangelfall gegeben.
Die Situation greift § 1609 BGB auf und erklärt, dass es ein Rangverhältnis unter den Unterhaltsgläubigern gibt. Erst, wenn ein Mangelfall vorliegt, wird § 1609 BGB relevant und führt dazu, dass vorrangige Unterhaltsgläubiger den nachrangigen Unterhaltsgläubigern den „Weg zum Kuchen“ versperren. § 1609 BGB erklärt nach seinem Wortlaut, welche Unterhaltspflichten in welcher Reihenfolge bis zur Grenze des dem Unterhaltspflichtigen zu belassenden Selbstbehalts voll zu erfüllen sind.
Zweiter Schritt
Rangfragen klären mit § 1609 BGB

BGH, Beschluss vom 01.10.2014 – XII ZB 185/13
Zum Rangverhältnis zwischen Ehegattenunterhalt und Betreuungsunterhalt für neue Lebenspartnerin
Leitsatz:
Besteht ein Teilunterhaltsanspruch auf Betreuungsunterhalt und ein weiterer Teilanspruch aufgrund eines anderen Unterhaltstatbestands, unterfällt der Gesamtanspruch [der neuen Lebenspartnerin] dem Rang des § 1609 Nr.2 BGB.
§ 1609 BGB | Gesetzestext
Sind mehrere Unterhaltsberechtigte vorhanden und ist der Unterhaltspflichtige außerstande, allen Unterhalt zu gewähren, gilt folgende Rangfolge:
- minderjährige unverheiratete Kinder und Kinder im Sinne des § 1603 Abs. 2 Satz 2,
- Elternteile, die wegen der Betreuung eines Kindes unterhaltsberechtigt sind oder im Fall einer Scheidung wären, sowie Ehegatten und geschiedene Ehegatten bei einer Ehe von langer Dauer; bei der Feststellung einer Ehe von langer Dauer sind auch Nachteile im Sinne des § 1578b Abs. 1 Satz 2 und 3 zu berücksichtigen,
- Ehegatten und geschiedene Ehegatten, die nicht unter Nummer 2 fallen,
- Kinder, die nicht unter Nummer 1 fallen,
- Enkelkinder und weitere Abkömmlinge,
- Eltern,
- weitere Verwandte der aufsteigenden Linie; unter ihnen gehen die Näheren den Entfernteren vor.
Mangelfallberechnung
mit Rangfragen gem. § 1609 BGB
Einkommensbereinigung im Rahmen der Bedarfsermittlung wegen mehreren Unterhaltsberechtigten?
Es gilt zu beachten, dass § 1609 BGB keine Vorschrift ist, die für die Bedarfsermittlung von Bedeutung ist.
Deshalb kann die Unterhaltsschuld gegenüber vorrangigen Unterhaltsschuldnern keine Abzugsposition vom Einkommen des Unterhaltspflichtigen für die Bedarfsermittlung nachrangiger Unterhaltsschuldner sein, soweit dies nicht bereits im Rahmen der üblichen Bedarfsermittlungsmethoden höchstrichterlich anerkannt ist (z.B. beim Ehegattenunterhalt: Abzug aller Kindesunterhaltslasten zur Einkommensbereinigung des Einkommens der Ehegatten).
Mithilfe des § 1609 BGB findet ausschließlich auf der Ebene der Ermittlung der Leistungsfähigkeit eine Mangelfall-Korrekturrechnung statt.
Gleichrangig Unterhaltsberechtigte
Die Düsseldorfer Tabelle zeigt unter Abschnitt C. ein Muster für eine Mangelfallberechnung beim Kindesunterhalt, wenn mehrere unterhaltsberechtigte Kinder sich auf der gleichen Rangstufe i.S.d. § 1609 BGB befinden.
Mangelfall bei gleichberechtigten Kindern in Patchwork-Situation
Situation: Ein wiederverheirateter Vater wird auf Unterhalt für ein minderjähriges Kind aus erster Ehe in Anspruch genommen. Er hat mit seiner neuen Ehefrau ein weiteres Kind. Die neue Ehefrau ist berufstätig und erbringt Betreuungsleistungen für das gemeinsame Kind. Wegen seines geringen Einkommens beruft sich der Vater wegen fehlender Leistungsunfähigkeit auf einen Mangelfall. Er sei finanzielle nicht in der Lage für beide Kinder den vollen Mindestunterhalt zu bezahlen.
Rechtsprechung: Das OLG Brandenburg hat mit Beschluss vom 29.02.2024 – 9 UF 40/21 für einen solchen Fall (Patchwork-Situation) entschieden, dass
- Der Selbstbehalt des Vaters wegen Zusammenleben mit seiner erwerbstätigen Ehefrau zu kürzen sei (Ersparnis wegen Synergie-Effekten) und
- der Barunterhalt für das Kind aus zweiter Ehe nur anteilig zu berücksichtigen sei. Denn die erwerbstätige Ehefrau sei beim Zusammenleben mit Ehemann und betreuten Kind anteilig mitverantwortlich für den Barunterhalt des gemeinsamen Kindes.

OLG Brandenburg,, Beschluss vom 29.02.2024 – 9 UF 40/21
Mangelfall in Patchwork-Situation: Unterhaltspflichtiger Vater mit gleichrangigen Kindern aus alter und neuer Ehe
Aus den Entscheidungsgründen:
(Zitat) “Vielmehr erbringen im hier dann vorliegenden Fall wechselseitiger Erwerbstätigkeit beide Eltern sowohl Betreuungs- wie auch Finanzierungsleistungen für den (geschuldeten Natural-)Unterhalt des gemeinsamen Kindes. Wollte man den – in tatsächlicher Hinsicht gerade nicht allein von ihm getragenen – Barunterhalt für den jüngeren Sohn allein dem Antragsgegner zurechnen, würde der hier betroffene ältere (Halb-)Bruder C… trotz der Gleichrangigkeit nach § 1609 Nr. 1 BGB unangemessen benachteiligt.
Liegt aber – wovon hier für die Zeit ab Juni 2022 auszugehen ist – tatsächlich eine Beteiligung auch der Mutter nicht nur in der Betreuung, sondern auch in der Finanzierung des gemeinsamen Kindes vor, ist es gerechtfertigt und zur Wahrung der Gleichrangigkeit aller minderjährigen Kinder tatsächlich auch erforderlich, den auf Seiten des Antragsgegners in eine etwaige Mangelfallberechnung einzusetzenden „Barunterhaltsanspruch“ des nachgeborenen Kindes anteilig nach den wechselseitigen (unterhaltsrechtlich bereinigten) Erwerbseinkünften der Kindeseltern zu berechnen.
Die gelebte finanzielle Mitverantwortung der Mutter für den Unterhalt des gemeinsamen Kindes wird also praktisch bedarfsdeckend angerechnet. Der Senat legt in solchen Fällen grundsätzlich das tatsächlich vorhandene Einkommen des anderen Elternteils (hier der Mutter) dieses weiteren Kindes zugrunde, weil sich L… etwaige Erwerbsobliegenheitsverstöße seiner Mutter jedenfalls nicht zurechnen lassen muss.
Da für die Bemessung der „Haftungsquote“ des Antragsgegners für den „Barunterhalt“ von L… ein tragfähiger Vortrag fehlt, geht der Senat in ständiger Rechtsprechung von einer hälftigen Beteiligung beider Eltern aus. Daraus folgt, dass in die Mangelfallberechnung ab Juni 2022 der Unterhaltsanspruch von L… nur mit der Hälfte des Tabellen(zahl)betrages einzustellen ist.“
Anmerkung:
Bei der Betreuung eines Kindes im gemeinschaftlichen elterlichen Haushalt gibt es keine von vornherein feststehende Obergrenze der von den jeweiligen Elternteilen tatsächlich zu erbringenden Anteile an der Betreuung bzw. Versorgung ihres Kindes. Die einzelnen Anteile der Eltern hieran lassen sich in diesem Fall auch nicht exakt bestimmen. Mithin stellt das OLG Brandenburg für die Frage der finanziellen Beteiligung der Mutter am Barunterhalt für das eigene Kind auf einen Betreuungsanteil ab. § 1606 Abs. 3 Satz 2 BGB wird hier nicht angewendet.
Hier herrscht die Vorstellung, dass beide Eltern gemeinsam in einen Topf (Haushalt) wirtschaften und jeder Elternteil seinen Beitrag entsprechend seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit leistet. Maßstab für die finanzielle Berücksichtigung des Kindes ist also der Einkommensanteil der jeweiligen Eltern. Wenn die Mutter nicht arbeiten geht, wird die finanzielle Last durch das Kind beim allein verdienenden Vater zu 100 % berücksichtigt.
Sobald die Mutter neben Kinderbetreuung auch erwerbstätig ist, entlastet das die gemeinsame Haushaltskasse. Wird zum Einkommensanteil der Mutter für den gemeinsamen Haushalt nicht konkret vorgetragen, dann wird vermutet, dass ihr Anteil 50 % beträgt, wenn nicht etwas anderes vorgetragen und glaubhaft gemacht wird. Das ist die Kernaussage der Entscheidung des OLG Brandenburg,, Beschluss vom 29.02.2024 – 9 UF 40/21.
Nachrangig
Unterhaltsberechtigte
Erst wenn der Unterhaltsbedarf der nach § 1609 Ziff.1 BGB vorrangigen Kinder gedeckt ist (Rangstufe 1), kann ein nachrangiger Unterhaltsberechtigter der Rangstufe 2 (§ 1609 Ziff. 2 BGB: Ehegatte, Mutter oder geschiedener Ehegatte) zum Zug kommen.
Beispiele zur Berechnung des Unterhalts nachrangig Berechtigter
» Guhling, in: Wendl/Dose, Das Unterhaltsrecht in der familienrechtlichen Praxis, 10. Aufl., § 5 Rn. 150ff.
» Zur Leistungsfähigkeit für Volljährigenunterhalt neben Kindesunterhalt für Kinder der Rangstufe 1
» OLG Saarbrücken, Urteil v. 11.01.2012 – 6 WF 1/12: Rangverhältnis bei mehreren Kindern
» BGH, Urteil vom 09.01.2002 – XII ZR 34/00: Rangverhältnis bei privilegierten volljährigen Kindern & minderjährigen Kindern und die Haftungsanteilsrechnung für priviliegiert volljährige Kinder
» BGH, Urteil vom v. 25.01.2012 – XII ZR 139/09 : Rangverhältnis bei mehreren beteiligten Ehefrauen
Darlegungs- und Beweislast
für Leistungsunfähigkeit

OLG Hamm, Beschluss vom 21.11.2012 – II-8 UF 14/12
Darlegungslast für Leistungsunfähigkeit beim Elternunterhalt
Anmerkung:
Der Unterhaltsschuldner hat sämtliche unterhaltsrelevanten Umstände darzulegen, wenn er sich gegen den Unterhaltsanspruch mit Berufung auf Leistungsunfähigkeit wehren will. Dazu ist er gezwungen, seine wirtschaftlichen Verhältnisse offenzulegen. Trägt der Unterhaltspflichtige zu seiner Leistungsfähigkeit im Unterhaltsverfahren nichts vor, wird ihm unbegrenzte Leistungsfähigkeit unterstellt.
- Falsche Angaben:
Werden vom Unterhaltspflichtigen im Unterhaltsverfahren falsche Angaben zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gemacht, hat dies negative zivilrechtliche und strafrechtliche Folgen. - Leitungsfähig wegen fiktivem Einkommen:
In der Praxis wird der Unterhaltspflichtige oft mit der Zurechnung fiktiver Einkünfte konfrontiert, die ebenfalls seine Leistungsfähigkeit bestimmten. Voraussetzung dafür ist der Vorwurf eines Verstoßes gegen die Obliegenheit zur Einkommensoptimierung. Hier kommt es darauf an, wer im Unterhaltsverfahren eine solche Obliegenheitsverletzung darlegen und beweisen muss.
FAQ: Leistungsfähigkeit und Eigenbedarf im Unterhaltsrecht
Was ist unter “Leistungsfähigkeit” im Unterhaltsrecht zu verstehen?
Die Leistungsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Unterhaltspflichtigen, Unterhaltszahlungen zu leisten, ohne den eigenen angemessenen Lebensunterhalt zu gefährden. (§ 1603 Abs. 1 BGB)
Was bedeutet Eigenbedarf, und wie wird er bestimmt?
Der Eigenbedarf bezeichnet den Teil des Einkommens, der dem Unterhaltspflichtigen für den eigenen Lebensunterhalt verbleiben muss. Er wird durch die Selbstbehaltssätze der Düsseldorfer Tabelle sowie unterhaltsrechtliche Leitlinien festgelegt.
Wann kann der Selbstbehalt an individuelle Verhältnisse angepasst werden?
Anpassungen sind möglich bei hohen Wohnkosten, Synergieeffekten durch Zusammenleben mit Partnern oder geringeren realen Lebenshaltungskosten. (§ 1603 Abs. 2 BGB)
Wie wird die Leistungsfähigkeit bei schwankendem Einkommen ermittelt?
Einkommensschwankungen beeinflussen die Leistungsfähigkeit kurzfristig, während der Unterhaltsbedarf auf einer langfristigen Prognose basiert. Aktuelle Veränderungen werden jedoch bei der Berechnung berücksichtigt.
Was geschieht bei mehreren Unterhaltsberechtigten?
Kann der Unterhaltspflichtige nicht alle Ansprüche vollständig erfüllen, erfolgt eine Rangfolge gemäß § 1609 BGB. Minderjährige Kinder und privilegierte Volljährige haben Vorrang.
Welche Faktoren beeinflussen den angemessenen Eigenbedarf?
Faktoren sind z. B. Erwerbstätigkeit, Wohnkosten und individuelle Lebensverhältnisse. Bei erwerbstätigen Personen ist der Selbstbehalt höher, um einen Anreiz zur Arbeitstätigkeit zu schaffen.
Was passiert im sogenannten Mangelfall?
Im Mangelfall reicht das Einkommen des Unterhaltspflichtigen nicht aus, um alle berechtigten Unterhaltsansprüche zu decken. Die Unterhaltsansprüche werden dann anteilig gekürzt, wobei vorrangige Ansprüche zuerst erfüllt werden.

Diese FAQ bieten eine Grundlage für die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema Leistungsfähigkeit.
Für spezifische Fälle empfiehlt es sich, rechtliche Beratung einzuholen.

Formulare zur Auskunft und Einkommensermittlung:
Von Fachanwälten in der Praxis geprüft und empfohlen.
Links & Literatur
Links
Kindesunterhalt & Leistungsfähigkeit
Elternunterhalt & Leistungsfähigkeit
Nachehelicher Unterhalt & Leistungsfähigkeit
Trennungsunterhalt & Leistungsfähigkeit
Professionelle Unterhaltsberechnung
Literatur
Hans-Ulrich Graba, Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Unterhaltsrecht im Jahr 2014, FF 2015, 225
Hans-Ulrich Graba, Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Unterhaltsrecht im Jahr 2013, FF 2014, 50
In eigener Sache
Mangelfall, Bezug von Krankengeld des barunterhaltspflichtigen Vaters, Korrektur des Selbstbehalts wegen mietfreiem Wohnen, unser Az.: 43/ 16 (D3/491- 16)
Mangelfall und Streit um Kindesunterhalt gegen einen (wieder verheirateten) Vater von vier Kindern aus Österreich mit einem Kind aus erster Ehe in Deutschland, unser Az.: 119/ 15
AG Augsburg – 412 F 3444/18, erhöhter notwendiger Selbstbehalt wegen Mietkosten in München, unser Az.: 12/ 19 (D3/543- 19)
AG München, Beschluss vom 23.10.2015 – 523 F 2292/15, erhöhter angemessener Selbstbedarf des Unterhaltsschuldners wegen Mietkosten in München, unser Az.: 85/ 15 (D4/218- 15)
