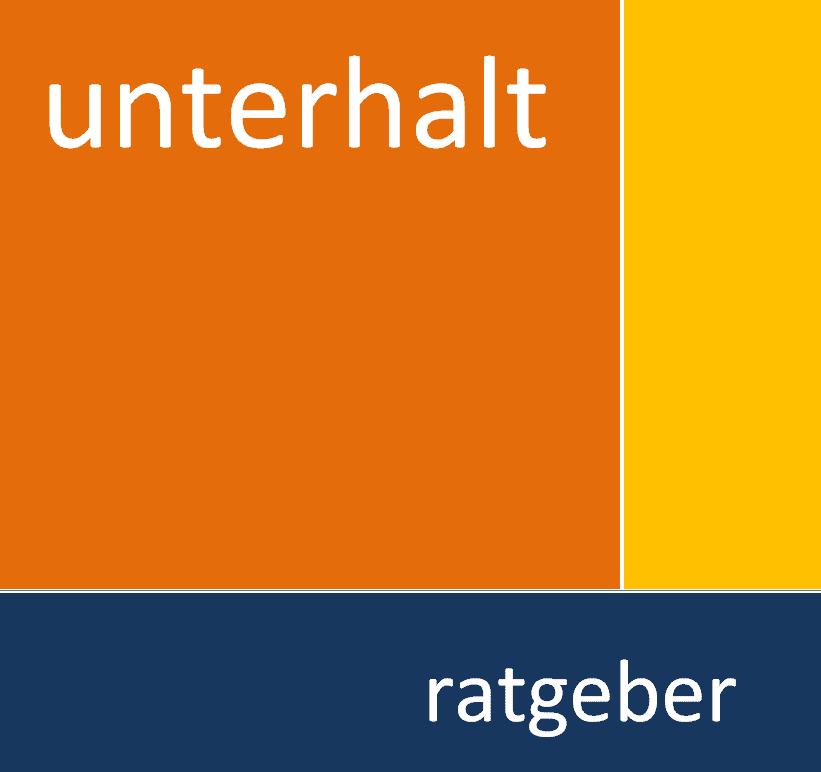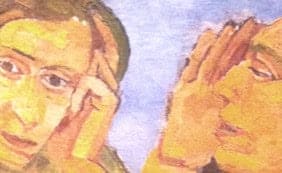- Dein Warenkorb ist leer.
Auskunftspflicht wegen Unterhalt
Rechtsgrundlagen
Standort:
Scheidung > Kanzlei > Infothek > Unterhalt > Auskunft im Unterhaltsrecht > Auskunft verlangen > Auskunftspflicht
Auskunft wegen Unterhalt erteilen – Wie geht das?
Im Familienrecht spielt die Auskunftspflicht eine zentrale Rolle – insbesondere dann, wenn es um Unterhaltsansprüche geht. Ob bei Trennung, Scheidung oder bei der Geltendmachung von Kindes- oder Ehegattenunterhalt: Ohne verlässliche Informationen über Einkommen und Vermögen kann keine faire Berechnung erfolgen. Die Seite erklärt verständlich, wer wann und in welchem Umfang zur Auskunft verpflichtet ist – und welche Rechte und Pflichten daraus entstehen.
Formulare zur Auskunft
| Formulare zur Auskunft und Ermittlung des Einkommens
In der Praxis erprobt und von führenden Fachanwälten empfohlen –
Ihre zuverlässige Lösung für höchste Effizienz und rechtliche Sicherheit!Unser Fachwissen in Berechnungen von Unterhalt basiert auf jahrzehntelanger Praxiserfahrung. Dies hat uns geholfen, spezielle Formulare mit Checklisten für die Praxis zur rechtssicheren Ermittlung und zur Auskunft über das unterhaltsrelevante Einkommen und Vermögen zu entwickeln.
Rechtlicher Leitfaden
| Wie formuliert man ein effektives Auskunftsverlangen?
Wollen Sie Unterhalt verlangen oder werden Sie mit einem Auskunftsverlangen konfrontiert, handeln Sie!
| Wegweiser zur Auskunftspflicht
Eine Auskunftspflicht besteht nur, wenn sie mit einer gesetzlichen Anspruchsgrundlage begründet werden kann. Die Zentralnorm dafür ist § 1605 BGB. Hilft das nicht weiter, wird meist auf § 242 BGB zurückgegriffen.
Das Wichtigste in Kürze
Um die Unterhaltshöhe bestimmen zu können, müssen alle Parteien vollständige Kenntnis über das unterhaltsrelevante Einkommen und Vermögen aller Beteiligten haben. Nur wenige Menschen sind bereit, dazu freiwillig Auskunft zu erteilen. Insbesondere nicht in dem Ausmaß, wie sie von der Gegenpartei verlangt wird.
Diese Zurückhaltung basiert oft auf der Sorge um die Privatsphäre und möglichen Missbrauch der Informationen. Nicht selten bestehen Befürchtungen, dass die gewonnenen Daten zu strategischen Nachteilen führen könnten oder im schlimmsten Fall öffentlich werden. Darüber hinaus kann die Offenlegung finanzieller Informationen das Gefühl der Verwundbarkeit verstärken, da finanzielle Verhältnisse als sehr persönlich und schützenswert betrachtet werden.
Deswegen ist es entscheidend, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Notwendigkeit der preisgegebenen Informationen gut zu verstehen.
Inhaltsverzeichnis | Wegweiser zu den Rechtsgrundlagen der Auskunftspflicht
§ 1605 Abs.1 BGB: Die zentrale Anspruchsgrundlage
§ 1605 Abs.1 BGB | Gesetzestext
(1) Verwandte in gerader Linie sind einander verpflichtet, auf Verlangen über ihre Einkünfte und ihr Vermögen Auskunft zu erteilen, soweit dies zur Feststellung eines Unterhaltsanspruchs oder einer Unterhaltsverpflichtung erforderlich ist. Über die Höhe der Einkünfte sind auf Verlangen Belege, insbesondere Bescheinigungen des Arbeitgebers, vorzulegen. Die §§ 260, 261 BGB sind entsprechend anzuwenden.
(2)…. dazu > hier
Umfassender Anwendungsbereich
Das Auskunftsverlangen soll die Beweisnot zur Darstellung der Unterhaltshöhe beseitigen und außergerichtlich Druck zur Auskunftspflicht erzeugen. Zwar gilt § 1605 BGB entsprechend seinem Wortlaut nur für den Verwandtenunterhalt. Doch zahlreiche Vorschriften zu den anderen Unterhaltsansprüchen verweisen zum Thema Auskunft auf den § 1605 BGB. Er gilt für fast jeden Unterhaltsanspruch und in fast jeder unterhaltsrechtlichen Fallvariante. Somit kann 1605 BGB als Zentralnorm für Fragen der außergerichtlichen Auskunftspflicht bezeichnet werden.
- Für den Verwandtenunterhalt gilt § 1605 BGB direkt.
- Trennungsunterhalt: § 1361 Abs.4 S.4 BGB verweist auf § 1605 BGB.
- Nachehelicher Unterhalt: § 1580 S.2 BGB verweist auf § 1605 BGB.
- Unterhalt aus Anlass der Geburt: § 1615l Abs.3 S.1 BGB verweist auf § 1605 BGB (OLG Frankfurt a. M. Beschluss vom 23.09.2004 – 6 UF 152/04).
Auskunftsansprüche außerhalb von § 1605 BGB
Auskunftsanspruch nach § 242 BGB

BGH, Beschluss vom 17.04.2013 – XII ZB 329/12
Auskunftspflichten zwischen den Eltern beim Volljährignunterhalt | § 242 BGB
Aus dem Inhalt:
Der Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 17. April 2013 befasst sich mit der Frage, ob ein geschiedener Elternteil verpflichtet ist, dem anderen Elternteil Auskunft über seine Einkünfte zu geben, wenn es um den Unterhalt für ein volljähriges Kind geht. In diesem Fall zahlte der Vater den vollen Ausbildungsunterhalt für sein volljähriges Kind aus eigenen Mitteln, ohne dass die Mutter derzeit für diesen Unterhalt aufkommen musste.
Die zentrale Aussage des BGH ist: Ein Elternteil, der freiwillig und ohne Verpflichtung den vollen Unterhalt für ein volljähriges Kind bezahlt, ist nicht verpflichtet, dem anderen Elternteil Auskunft über sein Einkommen zu erteilen, solange dieser keine Unterhaltsforderung gegen ihn erhebt oder keinen Ausgleichsanspruch geltend macht.
Um es einfach zu erklären: Eltern müssen nur dann Auskunft über ihr Einkommen geben, wenn sie selbst für den Unterhalt eines volljährigen Kindes in Anspruch genommen werden oder wenn die Beziehung zwischen den Eltern eine rechtliche Grundlage schafft, die diese Auskunftspflicht rechtfertigt. Wenn ein Elternteil jedoch den vollen Unterhalt selbst übernimmt und dabei nicht plant, anderen Elternteil in irgendeiner Form zurückzufordern, gibt es in der Regel keine Notwendigkeit zur Auskunft.
Zusammengefasst: Eltern müssen Auskunft über ihr Einkommen geben, wenn der eine Elternteil den anderen um Unterhalt bittet oder wenn rechtliche Ansprüche bestehen. Wenn ein Elternteil bereitwillig den gesamten Unterhalt bezahlt, ist keine Auskunft erforderlich.
Aus den Entscheidungsgründen
(Zitat, Rn 7): „Denn nach ständiger Rechtsprechung besteht nach Treu und Glauben dann ein Auskunftsanspruch, wenn zwischen den Beteiligten besondere rechtliche Beziehungen vertraglicher oder außervertraglicher Art bestehen, die es mit sich bringen, dass der Auskunftbegehrende entschuldbar über das Bestehen oder den Umfang seines Rechts im Unklaren und deshalb auf die Auskunft des Verpflichteten angewiesen ist, während dieser die Auskunft unschwer erteilen kann und dadurch nicht unbillig belastet wird (Senatsurteil BGHZ 191, 259 = FamRZ 2012, 200 Rn. 19 f.).
Dieser Grundsatz gilt trotz der im Familienrecht bestehenden Sonderbestimmungen (vgl. §§ 1580 und 1605 BGB) nach wie vor auch im Familienrecht. Die §§ 1580 und 1605 BGB regeln nur einen Teilbereich, in dem der Gesetzgeber die gegenseitigen Rechte und Pflichten präzisieren wollte. Dadurch wird aber eine in besonderen Fällen aus § 242 BGB herzuleitende Informationspflicht nicht ausgeschlossen (Senatsurteil vom 9. Dezember 1987 IVb 5/87 FamRZ 1988, 268 mwN).“
Anmerkung:
Wird im Verhältnis zwischen Unterhaltspflichtiger und Unterhaltsberechtigtem Auskunft verlangt, erübrigt sich ein Rückgriff auf die Vorschrift § 242 BGB als Anspruchsgrundlage. Denn § 1605 erfasst so gut wie alle Unterhaltsanspruchsbeziehungen.
Ein Rückgriff auf § 242 BGB kann aber dann erforderlich werden, wenn nach einem Auskunftsanspruch im Verhältnis von Personen gefragt wird, zwischen denen keine Unterhaltsanspruchsbeziehung existiert.
Der häufigste Fall dieser Art – kein Unterhaltsverhältnis, aber berechtigtes Bedürfnis nach Auskunft vom anderen – tritt auf, wenn beide Elternteile für den Unterhaltsanspruch ihres Kindes haften. Zwischen den Eltern besteht kein Unterhaltsverhältnis. Aber um ihre Haftungsquote bestimmen zu können, benötigen sie Auskunft zum Einkommen des anderen Elternteils. Auf solche und ähnliche Fälle wird im Folgenden eingegangen.
Auskunftsverpflichtung beim Kindesunterhalt wegen anteiliger Elternhaftung
Anlass für Auskunftsverpflichtung:
Auskunftsverpflichtung der Eltern untereinander kommt in Betracht, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Eltern anteilig für den Barunterhalt des Kindes haften. Das ist in folgenden Situationen der Fall:
- Kinderbetreuung im echten Wechselmodell (BGH FamRZ 2007, 707; 2006, 1015): Berechnungsbeispiel
- Haftung der Eltern für Mehrbedarf (BGH FamRZ 2009, 962; 2008, 1152): Berechnungsbeipiel
- Haftung der Eltern für Unterhalt des volljährigen Kindes
Weiterführende Links:
» Anteilige Elternhaftung
» Spezielle Fälle anteiliger Elternhaftung beim Unterhalt für minderjährige Kinder
» Auskunftsanspruch zwischen den Eltern beim Unterhalt für volljährige Kinder
Wechselseitige Auskunftsverpflichtung der Eltern beim Unterhalt für minderjährige Kinder:
Erhebliches wirtschaftliches Ungleichgewicht zwischen der Leistungsfähigkeit der Eltern
Es kommt häufig vor, dass der kinderbetreuende Elternteil die Auskunft zu seinem Einkommen verweigert. Dies mag zulässig sein, wenn den kinderbetreuenden Elternteil keine Unterhaltszahlungspflicht trifft. Letzteres ist aber nicht immer der Fall. Besteht wegen erheblichem wirtschaftlichen Ungleichgewicht Anlass, auch den kinderbetreuenden Elternteil am Barunterhalt für das Kind zu beteiligen, sind Fragen zum Haftungsanteil und Beteilugungsquote zu klären. Dies erzeugt einen Bedarf an Auskunft zum Einkommen beider Elternteile.
| Auskunft zum wirtschaftlichen Ungleichgewicht
Familienrechtlicher Ausgleichsanspruch zwischen den Eltern beim Kindesunterhalt
Ebenso kann die Auskunft erforderlich sein, um einen familienrechtlichen Ausgleichsanspruch zu berechnen, den der Bundesgerichtshof angenommen hat, um die Unterhaltslast gegenüber Kindern auch im Innenverhältnis zwischen den Eltern entsprechend ihrem Leistungsvermögen gerecht zu verteilen (BGHZ 31, 329, 332 = FamRZ 1960, 194, 195; BGHZ 50, 266, 270 = FamRZ 1968, 450, 451; Senatsurteil BGHZ 104, 224 = FamRZ 1988, 831, 833; vgl. auch Senatsurteil vom 20. Mai 1981 IVb ZR 558/80 FamRZ 1981, 761, 762). Denn auch die Höhe des Ausgleichsanspruchs richtet sich nach den Haftungsanteilen der Eltern, die nur in Kenntnis beider Einkommensverhältnisse berechnet werden können.
Auskunftspflicht Dritter – Lebenspartner in Patchwork-Situation
Es gibt immer wieder den Fall, dass der für sein Kind unterhaltspflichtige Elternteil in Zweit-Ehe neu verheiratet ist, selbst kaum Einkommen hat und der eigene Lebensunterhalt im Wesentlichen aus dem Einkommen des neuen Lebenspartners bestritten wird. Dies hat unterhaltsrechtliche Konsequenzen, und zwar in Form der Zurechnung von fiktiven Einkünften und Korrektur des Selbstbehalts (Leistungsfähigkeit bei Patchwork), wofür das Einkommen des neuen Lebenspartners bekannt sein muss.
Auch wenn der neue Lebenspartner nichts mit dem Unterhaltsverhältnis des barunterhaltspflichtigen Kindes zu tun hat (nicht sein Kind), trifft ihn eine Auskunftspflicht über sein Einkommen. Für manche Lebenspartner mag das unzumutbar weit in Ihre Privatsphäre eingreifen. Der BGH meint, das müsse hingenommen werden:
| Patchwork & Einkommen im Unterhaltsrecht

BGH, Urteil v. 2.6.2010 – XII ZR 124/08
Auskunftsansprüche bei Patchwork-Situation | Auskunftsanspruchs wegen Taschengeldanspruch
Auskunftspflicht
Hier geht es um die Frage, welche Auskunftsansprüche bestehen, um an Informationen zur Ermittlung der Höhe des Taschengeldanspruchs des Unterhaltspflichtigen (Taschengeldanspruch gegen seinen (neuen) Ehegatten zu kommen, um die Leistungsfähigkeit für Kindesunterhalt festzustellen.
(Zitat, Rn 22) „Ehegatten haben nach den §§ 1360, 1360 a BGB einen Anspruch auf Familienunterhalt. Dieser kann aber nur bei genauer Kenntnis der Einkommensverhältnisse des anderen Ehegatten beziffert werden. Aus der Verpflichtung zur ehelichen Lebensgemeinschaft (§ 1353 Abs. 1 Satz 2 BGB) folgt deshalb auch der wechselseitige Anspruch, sich über die für die Höhe des Familienunterhalts und eines Taschengeldes maßgeblichen finanziellen Verhältnisse zu informieren.
Seinem Umfang nach geht dieser Anspruch nicht nur auf eine Unterrichtung in groben Zügen, da eine derart eingeschränkte Kenntnis den Ehegatten nicht in die Lage versetzten würde, den ihm zustehenden Unterhalt zu ermitteln. Geschuldet wird deshalb die Erteilung von Auskunft in einer Weise, wie sie zur Feststellung des Unterhaltsanspruchs erforderlich ist.
Die Auskunftspflicht entspricht damit derjenigen, wie sie nach § 1605 Abs. 1 Satz 1 BGB besteht. Eine solche Verpflichtung läuft nicht etwa dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme der Ehegatten zuwider; diese erfordert vielmehr gerade, den anderen ausreichend über die eigenen Einkommensverhältnisse zu unterrichten.
Belegpflicht
Eine Pflicht zur Vorlage von Belegen besteht jedoch nicht (vgl. Rn 23). Allerdings besteht eine Pflicht zur Vorlage von Steuerbescheiden bei gemeinsamer Veranlagung
(Zitat, Rn 16) “Nach der Rechtsprechung des Senats muss der Ehegatte eines Unterhaltspflichtigen es zum Beispiel hinnehmen, dass der Unterhaltspflichtige im Rahmen der zu belegenden Auskunft über sein Einkommen Steuerbescheide vorzulegen hat, die aufgrund einer Zusammenveranlagung der Ehegatten ergangen sind. In einem solchen Fall können zwar die Angaben geschwärzt werden, die von dem Auskunftsanspruch nicht umfasst werden.
Soweit der Steuerbescheid aber Angaben enthält, in denen Beträge für Ehemann und Ehefrau zusammengefasst sind, bleibt es bei der Vorlagepflicht, falls insofern Auskunft zu erteilen ist. Wenn hierdurch Schlüsse auf die Verhältnisse des Ehegatten bezogen werden können, muss dies hingenommen werden (Senatsurteil vom 13. April 1983 – IVb ZR 374/81 – FamRZ 1983, 680, 682). Daraus ergibt sich, dass das Interesse des Auskunftbegehrenden dem Geheimhaltungsinteresse des Auskunftspflichtigen oder einem Dritten grundsätzlich vorgeht (st. Rechtsprechung, vgl. etwa Senatsurteil vom 6. Oktober 1993 – XII ZR 116/92 – FamRZ 1994, 28 f.)”
Auskunftsanspruch gem. § 242 BGB in Sorgerechtsangelegenheiten

OLG Oldenburg, Beschluss vom 19.02.2018 – 4 WF 11/18
Geldanlage für ein minderjähriges Kind – Auskunftsanspruch der Eltern untereinander bei gemeinsamer elterlicher Sorge
Anmerkung:
Nicht selten kümmern sich Eltern auch um Vermögensangelegenheiten ihrer minderjährigen Kinder. Dazu sind sie rechtlich grundsätzlich auch befugt. Sie üben dann die Vermögenssorge als Teil der elterlichen Sorge aus. Hierunter fallen auch Eröffnungen von Sparbüchern und Konten und andere diverse Geldanlagen. Bei Getrenntlebenden oder geschiedenen Eltern kann es bei Fragen der Vermögenssorge durchaus unterschiedliche Ansichten geben. Dies gilt insbesondere, wenn die Eltern gemeinsames Sorgerecht haben. Dann stellt die gemeinsame Vermögenssorge ein Teil der gemeinsamen elterlichen Sorge dar.
Es besteht dann unter den Eltern ein Auskunftsanspruch. Verfügt beispielsweise ein Elternteil bei gemeinsamer elterlicher Sorge unberechtigt alleine über das Sparvermögen des gemeinsamen Kindes, in dem er ein neues Sparkonto errichtet, steht in diesem Fall dem anderen Elternteil ein Auskunftsanspruch über den Verbleib des Geldes aufgrund der gemeinsamen Vermögenssorge als Teil der gemeinsamen elterlichen Sorge gem. § 242 BGB zu. Bei einer solchen Vermögensangelegenheit handelt es sich auch bei gemeinsamer elterlichen Sorge um eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung, die nicht von einem Elternteil alleine entschieden werden kann
Sorgerecht bedeutet Entscheidungsbefugnis der Eltern bei Angelegenheiten, die das Kind betreffen. Um richtige Entscheidungen treffen zu können, bedarf es ausreichender Kenntnis der Entscheidungsgrundlagen und Kriterien. Somit folgt aus dem Sorgerecht ein Auskunftsrecht und Auskunftspflichten der Eltern untereinander, die Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung (§ 1628 BGB) für das gemeinsame Kind betreffen.
Lt. der Entscheidung hatte ein Elternteil bei gemeinsamer elterlicher Sorge unberechtigt alleine über das Barvermögen des gemeinsamen Sohnes durch Einrichtung eines neuen Sparkontos verfügt. In diesem Fall steht dem anderen Elternteil ein Auskunftsanspruch über den Verbleib des Geldes aufgrund der gemeinsamen Vermögenssorge als Teil der gemeinsamen elterlichen Sorge gemäß § 242 BGB zu.
- Weiterführender Link:
» Informationsrecht der Eltern
» zur Vermögenssorge der Eltern (Vermögensverwaltung für das Kind) und Auskunft
Anspruch auf Grundbucheinsicht | §§ 12, 12c GBO

OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 7.01.2020 – 20 W 269/19
Grundbucheinsicht in Grundbuch des Unterhaltspflichtigen
Anmerkung:
Ein berechtigtes Interesse für die Grundbucheinsicht kann die Ermittlung eines Wohnvorteils und Zurechnung von fiktiven Mieteinkünften sein. Das OLG geht auf die Voraussetzungen (berechtigtes Interesse des Unterhaltsberechtigten) einer Grundbucheinsicht nach §§ 12, 12c GBO ein. Weiter wird erklärt, in welche Abteilungen des Grundbuchs Einsicht gewährt wird.
Wann entsteht eine Auskunftspflicht?
- In der Regel löst erst ein außergerichtliches, ordnungsgemäßes Auskunftsverlangen die Auskunftspflicht aus.
- Ist das Stadium eines gerichtlichen Unterhaltsverfahrens erreicht, tritt eine verfahrensrechtliche Auskunftspflicht hinzu.
- Dies kann bis hin zur ungefragten Auskunftsobliegenheit reichen, z. B. wenn sich nach einem Unterhaltstitel dessen Bemessungsgrundlagen geändert haben.
Wer ist zur Auskunft verpflichtet?
Wechselseitige Auskunftspflicht von Unterhaltspflichtigen und Unterhaltsberechtigten
§ 1605 BGB unterscheidet nicht zwischen Auskunftspflicht des Unterhaltspflichtigen und des Unterhaltsberechtigten. Die Auskunftspflicht besteht wechselseitig, soweit die Auskunft zu den Unterhaltsbemessungsgrundlagen für die Unterhaltsermittlung erforderlich ist (§ 1605 Abs.1 S.1 BGB). Grundlage der wechselseitigen Auskunftspflicht ist ein Unterhaltsverhältnis zwischen Auskunftsberechtigtem und Auskunftspflichtigen. Fehlt ein solches Verhältnis, muss sich die Unterhaltspflicht aus einer anderen Anspruchsgrundlage ergeben.
Zurückbehaltungsrecht wegen Auskunftspflichtverletzung?
Erteilt der Unterhaltsberechtigte trotz Aufforderung keine Auskunft zum eigenem Einkommen, obwohl dieses zur korrekten Unterhaltsermittlung erforderlich ist, kann sich der Unterhaltspflichtige u.U. auf ein Zurückbehaltungsrecht (§ 273 Abs.1 BGB) von Unterhaltsleistungen berufen (vgl. z.B. Zurückbehalt von Unterhaltsleistungen der Eltern beim Unterhalt ihrer volljährigen Kinder).
Erforderlichkeit der Auskunft
„Erforderlich“ – Was bedeutet das?
Nach dem Wortlaut des § 1605 BGB besteht eine Auskunftspflicht, soweit Auskunft verlangt (§ 1613 Abs.1 BGB) wurde und sie für unterhaltsrechtliche Zwecke „erforderlich“ist. Das bedeutet, eine Auskunftspflicht besteht nicht, wenn die begehrte Auskunft den Unterhaltsanspruch unter keinem Gesichtspunkt beeinflussen kann (BGH NJW 1982, 2771 = FamRZ 1982, 996 FamRZ 1985, 791 OLG Düsseldorf FamRZ 1998, 1191).
Dies ist der Fall, wenn sich die Erteilung der Auskunft zum Einkommen als bloße Förmelei ohne Sinn und Zweck darstellt. Auskunftspflicht zum Vermögen besteht, wenn die Relevanz des Vermögens dargelegt wird. Sogar im Fall der konkreten Bedarfsermittlung (wenn das (Gesamt-)Einkommen keine entscheidende Rolle für die konkrete Höhe des Unterhalts spielt) wird das Einkommen relevant, um die Angemessenheit des konkret dargelegten Bedarfs beurteilen zu können. Keine außergerichtliche Auskunftspflicht besteht,
- bei fehlender Bedürftigkeit des Unterhaltsbegehrenden (OLG Düsseldorf, 30.07.1986 – 2 Ss OWi 290/86),
- wenn der Unterhaltspflichtige evident nicht leistungsfähig ist (OLG Naumburg, 22.01.2001 – 14 WF 180/00),
- bei voller Verwirkung des Unterhaltsanspruchs nach § 1579 BGB, d.h. bei Vorliegen von Umständen, die auch ohne Einbeziehung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse den Unterhaltsanspruch zweifelsfrei entfallen lassen (BGH, 29.06.1998 – IV ZR 391/81).
- Weiterführende Links:
» Erforderlichkeit der Vermögensauskunft
» Erforderlichkeit bei Erklärung der unbegrenzten Leistungsfähigkeit
Sich unbegrenzt leistungsfähig erklären – Macht das Sinn?
Bedarfsermittlung bei gehobenem Lebensstandard
Bei sehr günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen kann sowohl beim Ehegattenunterhalt als auch beim Kindesunterhalt der Unterhaltsbedarf konkret ermittelt werden. Um den Unterhaltsberechtigten (Kinder oder Ehegatten) in die konkrete Bedarfsermittlung zu zwingen, war es gängige Praxis, dass der Unterhaltspflichtige keine Auskunft über sein Einkommen erteilte, indem er seine unbegrenzte Leistungsfähigkeit behauptete (BGH, vom 22.06.1994 – XII ZR 100/93 in: NJW 1994, 2618 ; OLG Karlsruhe, 26.08.1999 – 2 UF 288/98, in NJW-RR 00, 1026).
- Weiterführende Links:
» Bedarfsermittlung beim Ehegattenunterhalt
» Bedarfsermittlung beim Kindeunterhalt
» Konkrete Bedarfsermittlung
Beim Ehegattenunterhalt – BGH, Beschluss vom 15.11.2017 – XII ZB 503/16
- Der BGH (Entscheidung vom 15.11.2017 – XII ZB 503/16) hat der Taktik mit Erklärung der unbegrenzten Leistungsfähigkeit eine Absage erteilt: Allein aufgrund der Erklärung des Unterhaltspflichtigen, er sei „unbegrenzt leistungsfähig“, entfällt der Auskunftsanspruch noch nicht (Fortführung von Senatsurteil vom 22. Juni 1994 – XII ZR 100/93 – FamRZ 1994, 1169).
Mit Erklärung der „unbegrenzten Leistungsfähigkeit“ kann der Unterhaltspflichtige nicht auf die Unterhaltsermittlung nach Maßgabe seines Einkommens verzichten, um sich damit seiner Auskunftsverpflichtung zu entziehen. Selbst wenn bei sehr guten Einkommensverhältnissen die Bedarfsermittlung nicht nach Maßgabe des Einkommens des Unterhaltspflichtigen erfolgt, weil zweifelsfrei die Methode der konkreten Bedarfsermittlung anzuwenden ist, muss lt. BGH dennoch Auskunft zum Einkommen erteilt werden. - Die Erklärung der unbegrenzten Leistungsfähigkeit hat grundsätzlich nur Bedeutung für die Prüfungsebene zur Leistungsfähigkeit. Die Erklärung kann dazu führen, dass der Auskunftspflichtige im weiteren Verfahren nicht mehr mit Einwendungen gegen die Leistungsfähigkeit gehört wird (z.B. mit Einwand eines Verstoßes gegen den Halbteilungsgrundsatz beim Ehegattenunterhalt). Denn er setzt sich damit entgegen den Grundsätzen von Treu und Glauben mit seinem früheren Vortrag in unlösbaren Widerspruch.
Beim Kindesunterhalt
Beim Kindesunterhalt hat der BGH in Bezug auf die Auskunftspflicht des barunterhaltspflichtigen Elternteil eine Angleichung zu den Rechtsprechungsgrundsätzen beim Ehegattenunterhalt vollzogen. Obwohl beim Kindesunterhalt völlig andere Bedarfsermittlungsmethoden gelten als beim Ehegattenunterhalt, kann auch hier einer Auskunftspflicht zum Einkommen nicht mit Berufung auf unbegrenzte Leistungsfähigkeit entkommen werden.
Denn seit Rechtsprechung des BGH im September 2020 ist eine fiktive Fortschreibung der Düsseldorfer Tabelle – über die höchste Einkommensgruppe der Tabelle hinaus – zulässig. Dadurch wird die Einkommensauskunft für die Bedarfsermittlung mittels fiktiver Fortschreibung der Düsseldorfer Bedarfssätze erforderlich.

BGH, Beschluss vom 16.09.2020 – XII ZB 499/19
Zur Auskunftspflicht trotz Berufung des Vaters auf unbegrenzte Leistungsfähigkeit
Zum Inhalt:
In dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) geht es um einen Rechtsstreit zwischen einer Tochter und ihrem Vater bezüglich des Kindesunterhalts und der Auskunft über sein Einkommen. Die Tochter, die bei ihrer Mutter lebt, verlangt von ihrem Vater die Offenlegung seines Einkommens und die Zahlung von Kindesunterhalt.
Der Vater hat sich in einer vorherigen Vereinbarung verpflichtet, einen bestimmten Betrag an Unterhalt zu zahlen. Zudem erklärt er sich für “unbegrenzt leistungsfähig”, was bedeutet, dass er bereit ist, Unterhalt zu zahlen, ohne zu behaupten, dass er nicht genug Geld dafür hat. Dennoch entsteht eine Streitfrage darüber, ob er weiterhin verpflichtet ist, Auskunft über sein Einkommen zu geben.
Das Amtsgericht hat entschieden, dass der Vater tatsächlich Auskunft geben muss, und das Oberlandesgericht hat diese Entscheidung bestätigt. Die höheren Gerichte betonen, dass der Vater Auskunft geben muss, solange seine finanzielle Lage für die Bestimmung des Unterhalts von Bedeutung sein könnte. Es wurde klargestellt, dass die genaue Höhe des Einkommens relevant ist, um zu entscheiden, wie viel Unterhalt angemessen ist und ob zusätzliche Kosten, beispielsweise für Horte oder Freizeitaktivitäten, gerechtfertigt sind.
Schließlich hat der BGH die Rechtsbeschwerde des Vaters zurückgewiesen, was bedeutet, dass das Gericht die Entscheidung der unteren Instanzen bestätigt hat, dass er Auskunft über sein Einkommen geben muss.
| Kindesunterhalt mit erweiterter Düsseldorfer Tabelle (seit 2022) ermitteln
- Weiterführende Links und Literatur:
» Sättigungsgrenze und Bedarfsermittlung mit Düsseldorfer Tabelle,
» Hamm/Weichselgartner, Zur Auskunftspflicht und Sättigungsgrenze beim Kindesunterhalt, in: NZFam 2020, 332
Auskunft zum Einkommen
Wird Auskunft zum Einkommen verlangt, erfüllt man die Auskunftspflicht nicht einfach dadurch, dass man der Gegenseite seine Einkommensbelege zur Verfügung stellt. Dazu ist weitaus mehr erforderlich.
- Weiterführende Links:
» Ordnungsgemäße Auskunft zum Einkommen erteilen
Auskunft zum Vermögen

Auskunftspflichten
zum Vermögen
Rechtsfolgen der Auskunftspflichtverletzung
Wer zur Auskunft verpflichtet ist, aber nicht ordnungsgemäß Auskunft erteilt, muss mit negativen Konsequenzen (Rechtsfolgen) rechnen. Das gilt vor allem dann, wenn in einem Unterhaltsverfahren falsche oder unvollständige Angaben zu den unterhaltsrelevanten wirtschaftlichen Verhältnissen erfolgen.

Auskunftspflichtverletzung
des Unterhaltsschuldners
FAQ – Auskunft wegen Unterhalt
Wer trägt die Beweislast bei der Unterhaltsermittlung?
Die Darlegungs- und Beweislast liegt sowohl beim Unterhaltsberechtigten als auch beim Unterhaltspflichtigen. Beide müssen ihre Ansprüche oder Einwände darlegen und nachweisen können.
Welche Belege sind notwendig, um den Unterhalt korrekt zu ermitteln?
Notwendig sind viele relevanten Belege, die sich meist im Besitz der Gegenpartei befinden.
Wie kann man vor einer Trennung finanzielle Informationen sichern?
Es sollten auf legale Weise Informationen wie Kontonummern, Arbeitgeberanschriften und Gehaltsnachweise notiert oder kopiert werden. Ein Diebstahl von Dokumenten ist strafbar.
Wann besteht eine Pflicht zur Auskunft?
Beide Seiten sind gesetzlich verpflichtet, Auskunft und Belege über Einkommen und Vermögen vorzulegen. Ein korrektes Auskunftsverlangen löst diese Pflicht aus.
Welche Rolle spielen gerichtliche Anträge bei der Durchsetzung des Auskunftsanspruchs?
Man kann ein Unterhaltsverfahren als Stufenantrag einleiten (zuerst Auskunft verlangen, dann Unterhalt fordern) oder direkt einen Leistungsantrag stellen.
Was passiert, wenn Zweifel an der Richtigkeit der Auskunft bestehen?
Bestehen Zweifel, kann die Gegenseite zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung aufgefordert werden, um die Richtigkeit zu bestätigen.
Welche rechtlichen Konsequenzen drohen bei Verletzung der Auskunftspflicht?
Bei Verstößen drohen gerichtliche Maßnahmen, wie Vollstreckung von Beschlüssen oder Sanktionen wegen Verletzung der prozessualen Wahrheitspflicht.

Diese FAQ bieten eine Grundlage für die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema Auskunft im Unterhaltsrecht.
Für spezifische Fälle empfiehlt es sich, rechtliche Beratung einzuholen.

Formulare zur Auskunft und Einkommensermittlung:
Von Fachanwälten in der Praxis geprüft und empfohlen.
Links & Literatur
Links
Professionelle Unterhaltsberechnung
Literatur
Winfried Born, Immer Ärger mit der Auskunft – ein unvermeidbares Problem?, in: FF 2016, 180 ff.
Thomas Herr, Anwaltstaktik beim Auskunftsanspruch, in: Familienrecht kompakt 11 | 2005
Beate Heiß, Pflicht zur unaufgeforderten Information, in: Heiß/Born, Unterhaltsrecht, 37. Auflage 2010, Rn 78 ff.
In eigener Sache
Wann wird beim Kindesunterhalt und gehobenen Einkommensverhältnissen keine Einkommensauskunft geschuldet?, unser Az.: 15/19 (D3/11-19)
Zeitsperre für neue Auskunft & Einkommensveränderungen, unser Az.: 328/13 (Mandanteninformation: D3/37-14)
Zurückweisung des Auskunftsanspruchs, weil nicht “erforderlich”, unser Az.: 513/16 (D3/1210-16)