- Dein Warenkorb ist leer.
Kindeswille setzt sich gegen Elternwiderstand durch | AG Traunstein setzt durch, OLG München bestätigt
In zwei aufeinanderfolgenden Entscheidungen haben das Amtsgericht Traunstein und das Oberlandesgericht München wegweisende Beschlüsse zum paritätischen Wechselmodell gefällt. Die Entscheidungen zeigen eindrucksvoll, unter welchen Voraussetzungen ein Wechselmodell auch gegen den ausdrücklichen Willen eines Elternteils durchgesetzt werden kann.
Der Fall ist von besonderer Bedeutung, da er die Grenzen der Kooperationspflicht, die Bedeutung des Kindeswillens und die Anforderungen an eine Abänderung bestehender Umgangsregelungen aufzeigt.
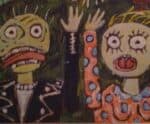
| Wechselmodell
gegen den Willen eines Elternteils
| Beschluss AG Traunstein vom 03.09.2025 – 003 F 571/24
| Beschluss OLG München vom 02.10.2025 – 12 UF 1101/25 e
| Beschluss OLG München vom 12.11.2025 – 12 UF 1101/25 e
Weitere Wegweiser zur Durchsetzung des Wechselmodells
| Kindeswille –
Auch auf meine Meinung kommt es an – Meine Einladung zum Familiengericht
(Broschüre des Bundesjustizministeriums der Justiz)
| Gerichtliche Durchsetzung eines Wechselmodells
Holen Sie sich eine klare Anleitung zur Durchsetzung der paritätischen Kinderbetreuung
Inhaltsverzeichnis | Wechselmodell gegen Elternwillen
Zusammenfassung der Entscheidungen
Das Amtsgericht Traunstein ordnete am 03. September 2025 die Abänderung einer bestehenden Umgangsvereinbarung an und installierte ein paritätisches Wechselmodell, bei dem die beiden Kinder wöchentlich zwischen den Elternteilen wechseln. Die Mutter legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte gleichzeitig die Aussetzung der Vollziehung des Beschlusses.
Das Oberlandesgericht München wies diesen Antrag am 02. Oktober 2025 zurück und bestätigte damit die sofortige Wirksamkeit des Wechselmodells. Die Beschwerde in der Hauptsache ist noch nicht entschieden, jedoch hat das OLG München deutlich gemacht, dass die Beschwerde nach summarischer Prüfung keine Aussicht auf Erfolg hat.
Der Sachverhalt
Familiäre Ausgangslage
Die getrennt lebenden Eltern zweier gemeinsamer Kinder im Alter von neun und sieben Jahren hatten im Februar 2023 eine Umgangsvereinbarung getroffen. Nach dieser Vereinbarung verbrachten die Kinder die Zeit von Donnerstag bis Dienstagabend 18:00 Uhr beim Vater und von Dienstagabend 18:00 Uhr bis Donnerstag bei der Mutter. Dies entsprach faktisch einer Verteilung von sechs Tagen beim Vater und acht Tagen bei der Mutter. Rechnet man die Übernachtungen, ergibt sich sogar ein Verhältnis von 5:9, da die Kinder von Dienstagabend bis Donnerstagvormittag mit insgesamt neun Übernachtungen bei der Mutter und mit fünf Übernachtungen beim Vater waren.
In der Vereinbarung hatten sich die Eltern verpflichtet, bis zum 30. Juni 2025 keine neuen Anträge zum Umgang oder zur elterlichen Sorge zu stellen. Diese sogenannte Stabilitätsklausel sollte den Kindern Ruhe verschaffen und sie vor weiteren belastenden Gerichtsverfahren schützen.
Veränderte Rahmenbedingungen
Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung im Februar 2023 lebten beide Eltern in Ruhpolding. Im Oktober 2023 zog die Mutter mit den Kindern nach Traunstein. Der Vater zog zunächst nach Siegsdorf und im April 2025 ebenfalls nach Traunstein. Die Wohnungen der Eltern befinden sich seither nur noch etwa einen Kilometer voneinander entfernt. Beide Kinder besuchen seit September 2024 die Montessori-Schule in Traunstein. Diese räumliche Nähe und die gemeinsame schulische Anbindung schufen völlig neue Voraussetzungen für eine paritätische Betreuung.
Die ursprüngliche Umgangsregelung war an die Gegebenheiten in Ruhpolding angepasst und wurde im Alltag bereits modifiziert, um den veränderten Umständen Rechnung zu tragen. Die Kinder nahmen in Traunstein an diversen Kursen teil, was die Umsetzung der ursprünglichen Regelung zunehmend kompliziert machte.
Der Antrag des Vaters
Am 08. Juli 2024 beantragte der Vater die Abänderung der Vereinbarung vom 06. Februar 2023 und strebte ein paritätisches Wechselmodell an. Dieser Antrag erfolgte vor Ablauf der vereinbarten Stabilitätsphase, die bis zum 30. Juni 2025 gelten sollte.
Begründung des Vaters
Der Vater stützte seinen Antrag auf mehrere zentrale Argumente:
Veränderte Wohnsituation als neue Sachlage: Die räumliche Nähe der Wohnungen und die gemeinsame Schule der Kinder ermöglichten erstmals eine gleichwertige Betreuung ohne logistische Hürden. Der Vater argumentierte, dass er die Vereinbarung von 2023 auch deshalb akzeptiert habe, weil er davon ausgegangen sei, dass sich an den Wohnverhältnissen nichts ändern würde. Durch die Umzüge beider Elternteile nach Traunstein seien die Grundvoraussetzungen der Vereinbarung entfallen.
Kindeswille als zentrales Argument: Beide Kinder hätten wiederholt gegenüber dem Vater geäußert, dass sie die aktuelle Zeitverteilung als ungerecht empfänden und sich wünschten, gleich viel Zeit bei beiden Elternteilen zu verbringen. Dieser Wunsch sei stabil über einen langen Zeitraum hinweg geäußert worden.
Praktische Umsetzungsprobleme: Durch die Vielzahl der Kurse der Kinder in Traunstein sei für den Vater an den Wochentagen kaum Zeit gewesen, diese selbst mit den Kindern zu verbringen. Die ursprüngliche Regelung habe ihm zwar formal sechs Tage zugestanden, faktisch aber habe er aufgrund der Entfernung und der Kurszeiten weniger qualitative Zeit mit den Kindern verbringen können als vorgesehen.
Kindeswohlaspekt: Der Vater trug vor, dass bereits im Jahr 2023 keine in der Person der Kinder liegenden Gründe gegen ein paritätisches Wechselmodell gesprochen hätten. Die neue Sachlage mache die bisherige Regelung nicht mehr kindeswohlgerecht. Nachdem sich auch die Wohnsituation komplett geändert habe, seien keine Gründe ersichtlich, warum an der Verpflichtung, innerhalb von zwei Jahren keinen Neuantrag zu stellen, festgehalten werden solle.
Die Position der Mutter
Die Mutter lehnte den Antrag entschieden ab und beantragte, ihn zurückzuweisen. Ihre Argumentation konzentrierte sich auf mehrere Schwerpunkte:
Verletzung der Stabilitätsvereinbarung
Die Mutter machte geltend, dass die Beteiligten sich verpflichtet hätten, bis zum 30. Juni 2025 keinen neuen Antrag zu stellen. Sie habe dieser Verpflichtung nur zugestimmt, um die Kinder vor weiteren Anhörungen und Befragungen zu schützen und ihnen eine stabile Umgangssituation zu ermöglichen. Der Antrag des Vaters vor Ablauf dieser Frist verletze diese Vereinbarung und zeige, dass er sich nicht an Absprachen halte.
Fehlende Kooperationsfähigkeit
Die Mutter argumentierte, dass die Kommunikations- und Kooperationsprobleme zwischen den Eltern sich mit der Ausweitung der Betreuungszeiten noch verschlechtert hätten. Ein Wechselmodell könne nur funktionieren, wenn die Eltern einen guten und belastbaren Umgang miteinander pflegten, was hier nicht der Fall sei. Ein paritätisches Wechselmodell setze eine tragfähige Kooperations- und Kommunikationsbasis der Eltern voraus, diese fehle jedoch.
Psychische Belastung der Kinder
Die Kinder befänden sich seit Juli 2023 in ambulanter Behandlung im sozialpädiatrischen Zentrum des Klinikums Traunstein aufgrund der Belastungssituation durch die hochkonfliktbehaftete Trennung der Eltern. Ein Wechselmodell würde die Kinder zusätzlich belasten und sie in einen Loyalitätskonflikt bringen. Die Kinder seien vor fortwährenden Umgangsverfahren zu schützen, und es sei eine stabile und dauerhafte Umgangssituation sicherzustellen.
Wirtschaftliche Motive
Die Mutter unterstellte dem Vater, dass er nicht aus kindeswohlbezogenen Gründen, sondern aus wirtschaftlichen Erwägungen (Reduzierung von Unterhaltszahlungen) das Wechselmodell anstrebe. Dies sei das eigentliche Motiv, nicht das Kindeswohl.
Bewährte Struktur
Die Mutter argumentierte, dass die bestehende 6/8-Regelung seit Februar 2023 bestehe und mit Schulstart vor zwei Jahren in einer nur geringfügig modifizierten Bringsituation gelebt werde. Die Praxis sei etabliert (Schule, Rhythmus Musikschule/Freizeit, Arzttermine/Therapien). Eine abrupte Systemänderung erhöhe den Anpassungs- und Loyalitätsdruck der Kinder. Die Fortführung der bestehenden Struktur bis zur OLG-Entscheidung vermeide zusätzliche Belastungen und schütze die schulische und soziale Einbettung der Kinder.
Minimale Änderung
Die Mutter vertrat die Auffassung, dass die Änderung des Umgangsmodells minimal sei, so dass deswegen ein neues Verfahren nicht gerechtfertigt sei. Bei einer bloßen zeitlichen Verschiebung von 6/8 auf 7/7 (“ein weiterer Tag”) sei die hohe Eingriffsschwelle des § 1696 Abs. 1 BGB nicht erreicht.
Unklarer Kindeswille
Die Mutter argumentierte, dass der geäußerte Kindeswille alters- und reifebezogen einzuordnen sei. Das ältere Kind habe keinen klaren Willen geäußert, und der Wunsch des jüngeren Kindes sei lediglich auf “Gerechtigkeit” gerichtet gewesen, nicht auf ein spezifisches Betreuungsmodell.
Berufliche Situation des Vaters
Die Mutter trug vor, dass der Vater Führungskraft und vollzeitberufstätig sei. Unter diesen Rahmenbedingungen sei derzeit nicht verlässlich dargetan, dass tägliche Betreuung, Pünktlichkeit zu Schule und Kursen sowie die Kontinuität der Förder- und Therapiemaßnahmen bei sofortigem 7/7-Umgangsmodell gesichert wären.
Die Stellungnahmen der Fachpersonen
Verfahrensbeiständin
Die mit Beschluss vom 09. Juli 2024 bestellte Verfahrensbeiständin Rechtsanwältin Susanna Voltz befürwortete in ihrer Stellungnahme vom 18. September 2024 die Einrichtung eines Wechselmodells. Sie stellte fest:
• Beide Elternteile seien voll umfänglich erziehungsfähig und beide sehr am Wohl der Kinder interessiert.
• Das ausgedehnte Umgangsrecht des Vaters funktioniere gut.
• Die Kommunikation und Kooperation auf der Elternebene sei ausreichend.
• Die Eltern würden beide von zu Hause aus arbeiten und seien zeitlich flexibel.
• Die letzten eineinhalb Jahre hätten gezeigt, dass die Eltern es gut geschafft hätten, sich bei Veränderungen abzustimmen und die einzelnen Kurse gemeinsam zu vereinbaren und zu finanzieren.
Die Verfahrensbeiständin betonte, dass die Kinder sehr gerne bei der Mutter seien und zu ihr ein sehr liebevolles Verhältnis hätten. Wenn sie aber vom Vater sprächen, seien sie ganz begeistert, die Augen würden funkeln. Es sei zu spüren, dass beim Vater deutlich mehr los sei und den Kindern das sehr gut gefalle. Die Mutter habe keine nachvollziehbaren, in den Kindern liegenden Gründe nennen können, die gegen ein Wechselmodell sprächen.
In einem weiteren Bericht vom 18. Juli 2025 bekräftigte die Verfahrensbeiständin ihre Empfehlung. Sie wies darauf hin, dass es den Eltern in den letzten zehn Monaten gut gelungen sei, ein sehr komplexes Umgangskonzept umzusetzen, das immer wieder durch Rücksprachen und Modifizierungen geklärt werden musste. Dies zeige eindrücklich, dass die von der Mutter heraufbeschworene fehlende Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit ein Scheinargument sei.
Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens gab die Verfahrensbeiständin am 30. September 2025 an, dass sie einer Aussetzung der sofortigen Vollziehung nicht zustimmen könne, da mit der Aussetzung des Beschlusses vom 03.09.2025 keine verbindliche Umgangsregelung mehr vorliegen würde. Es sei gerade nicht richtig, dass man auf die Vereinbarung vom 13.03.2023 zurückgreifen könne, da sich aufgrund des Umzugs beider Elternteile nach Traunstein die Parameter geändert hätten.
Tatsächlich würden die Kinder derzeit nur erleben, dass sie jetzt mehr Zeit mit dem Papa hätten. Sonst habe sich für die Kinder nichts verändert. Im Alltag der Kinder habe sich nichts geändert, was so einschneidend sei, dass es sich bei einer erneuten Abänderung in jedem Fall negativ für die Kinder auswirken würde. Die Kinder hätten konstant geäußert, dass sie gleiche Betreuungsanteile der Eltern wollten.
Sachverständigengutachten
Die Sachverständige Patricia Frenzel erstattete am 25. April 2025 ein umfassendes Gutachten zur Frage des Umgangs. Sie kam zu dem Schluss, dass unter Berücksichtigung der verträglichen Gegebenheiten und Möglichkeiten sowie der berechtigten Interessen der Eltern die Einführung des paritätischen Wechselmodells zum Wohl der Kinder am besten entspreche.
Die Sachverständige stellte fest:
•Die Kinder hätten überwiegend sichere Bindungen zu beiden Elternteilen.
•Beide Kinder wünschten sich Kontakt zum Vater.
•Um das Kindeswohl nicht weiterhin nachhaltig zu beeinträchtigen, sei es unabdingbar, den Elternkonflikt zu beenden.
•Das Wechselmodell stelle eine Chance für eine Befriedung des Elternkonflikts dar.
Die Sachverständige räumte zwar ein, dass der erhebliche Elternkonflikt ein Risiko für die zukünftige Elternkooperation darstelle, empfahl aber dennoch das Wechselmodell als kindeswohlfördernd. Sie führte aus, dass eine festgelegte Übergabezeit zu einer Entzerrung führen würde, zu weniger Hin und Her. Es würde mehr Klarheit für die Kinder entstehen. Die Kinder müssten eine grüne Linie haben. Der Kindeswunsch sei, jedenfalls bei dem jüngeren Kind, gleiche Zeit bei beiden Elternteilen. Es würde zu weniger Problemen kommen, wenn ein fester Tag für die Übergaben vereinbart werden würde.
Jugendamt
Auch der Vertreter des Jugendamts Traunstein sprach sich in der mündlichen Verhandlung vom 23. Juli 2025 für ein paritätisches Wechselmodell aus.
Die Kindesanhörung: Der entscheidende Faktor
Am 29. Juli 2025 wurden beide Kinder getrennt angehört. Ihre Aussagen waren eindeutig und übereinstimmend:
Aussage des jüngeren Kindes (7 Jahre)
Das jüngere Kind gab an, dass beide Eltern gleich viel Zeit haben sollten. Das sei gerecht. Es meine, beide jeweils sieben Tage. Früher habe es Streit zwischen Mama und Papa gegeben, der Streit sei weniger geworden oder gar nicht mehr. Das Kind äußerte sich positiv über den Halbbruder, der manchmal mit den Geschwistern spiele.
Aussage des älteren Kindes (9 Jahre)
Das ältere Kind gab bei der Kindesanhörung an, derzeit sei es immer acht Tage bei der Mama und dann sechs Tage beim Papa. Es wünsche sich, dass das gerechter sein solle. Es wolle, dass die Geschwister bei Mama und Papa gleich lang seien, nicht acht Tage bei der Mama und sechs Tage beim Papa. Es könne sich einen Wechsel am Freitag vorstellen. Das Kind äußerte: “Mein Wunsch wäre, dass die Eltern sich nicht mehr streiten würden und dass es gerechter sei. Ich habe den Papa ganz toll lieb, genauso lieb wie die Mama.”
Diese Aussagen waren für das Gericht von zentraler Bedeutung. Sie zeigten nicht nur den klaren Wunsch der Kinder nach einer paritätischen Zeitverteilung, sondern auch ihre Reife und Fähigkeit, ihre Bedürfnisse zu artikulieren. Beide Kinder betonten das Gerechtigkeitsempfinden und die gleichwertige Liebe zu beiden Elternteilen. Zudem nahmen sie wahr, dass der Elternkonflikt sich verringert hatte, was gegen die Befürchtung der Mutter sprach, dass ein Wechselmodell die Konfliktsituation verschärfen würde.
Die Entscheidung des Amtsgerichts Traunstein (03.09.2025)
Das Amtsgericht Traunstein folgte in seinem Beschluss vom 03. September 2025 dem Kindeswillen, den Empfehlungen der Verfahrensbeiständin, der Sachverständigen und des Jugendamts. Das Gericht ordnete die Abänderung der Vereinbarung vom 06.02.2023 an und installierte ein paritätisches Wechselmodell.
Die konkrete Regelung
Die neue Umgangsregelung sieht wie folgt aus:
| Zeitraum | Betreuungsperson |
| Gerade Kalenderwochen | Vater |
| Ungerade Kalenderwochen | Mutter |
Übergabe: Die Übergabe der Kinder findet jeweils am Freitag bei Schulschluss statt. Der Elternteil, bei dem sich die Kinder bis dahin aufgehalten haben, bringt die Kinder zu Schulbeginn in die Schule, und der andere Elternteil holt bei Schulschluss an der Schule ab.
Sofern der jeweilige Freitag kein Schultag ist, findet die Übergabe am Freitag um 10:00 Uhr an der Wohnung statt, in die die Kinder wechseln.
Beginn: Der erste Umgang nach der neuen Regelung fand in der Kalenderwoche 38 statt, beginnend am Dienstag, 16. September 2025 (Schulende erster Schultag nach den bayerischen Schulferien) bis Freitag, 19. September 2025.
Rechtliche Begründung
Das Gericht stützte seine Entscheidung auf § 1696 Abs. 1 BGB, der eine Abänderung einer Umgangsregelung ermöglicht, wenn triftige, das Wohl des Kindes nachhaltig berührende Gründe vorliegen.
Triftige Gründe
Das Gericht sah mehrere triftige Gründe als gegeben an:
Veränderte Wohnsituation: Die Mutter war nach der Regelung vom 06.02.2023 nach Traunstein umgezogen, der Vater folgte. Die Eltern leben nun nur noch etwa einen Kilometer voneinander entfernt. Dadurch ist eine neue Sachlage entstanden, die eine Neuregelung des Umgangs zulässt.
Schulbesuch: Beide Kinder besuchen seit September 2024 die Montessori-Schule in Traunstein. Die Veränderung der örtlichen Gegebenheiten führt dazu, dass Gründe entstanden sind, die eine Neuregelung des Umgangs zulassen, zumal schon im Verfahren 003 F 1013/23 vom Vater das Wechselmodell beantragt wurde.
Kindeswille: Die Kinder haben bei der Anhörung eindeutig und übereinstimmend geäußert, dass sie sich eine paritätische Zeitverteilung wünschen. Dieser Wille ist stabil über einen langen Zeitraum hinweg geäußert worden. Der Wille der Kinder sei zu beachten.
Kindeswohlprüfung
Das Gericht prüfte umfassend, ob das Wechselmodell dem Kindeswohl entspricht:
Bindungsqualität: Wie dem Sachverständigengutachten zu entnehmen ist, stellen beide Elternteile potentielle Bindungsfiguren und Hauptbezugspersonen dar. Auch nach der Trennung haben die Kinder konstant Kontakt zum Vater gehabt. Die Atmosphäre ist sowohl beim Vater als auch bei der Mutter warm und harmonisch gewesen. Die Kinder sind an beide Elternteile sicher angebunden. Es könne davon ausgegangen werden, dass die Kinder an beide Elternteile sicher angebunden seien.
Erziehungsfähigkeit: Beide Elternteile sind voll erziehungsfähig und sehr am Wohl der Kinder interessiert. Beide Eltern haben ausreichend große Wohnungen. Der Vater ist als Führungskraft tätig, die Mutter ist in der Rechtsabteilung der Allianz angestellt. Beide Elternteile arbeiten im Homeoffice und sind zeitlich flexibel.
Äußere Rahmenbedingungen: Die äußeren Rahmenbedingungen für ein Wechselmodell sind optimal gegeben. Die Eltern leben nur 1.000 Meter voneinander entfernt. Die Kinder besuchen beide die Montessori-Schule in Traunstein. Ihre Freizeit verbringen sie in Traunstein und nehmen dort an diversen Kursen teil. Derzeit würden die Kinder acht Tage beim Vater und acht Tage bei der Mutter verbringen und würden beide Elternteile mögen.
Kooperationsfähigkeit: Das Gericht stellte fest, dass die Eltern es bislang immer geschafft haben, sich zugunsten der Kinder zusammenzufinden. In den letzten zehn Monaten ist es den Eltern gut gelungen, ein sehr komplexes Umgangskonzept umzusetzen. Die Eltern waren in der Lage, zum Wohle der Kinder auf der tatsächlichen Ebene zusammenzuwirken. Die Eltern hätten es geschafft, sich zugunsten der Kinder zusammenzufinden. Neue Probleme durch die Einführung des Wechselmodells seien nicht zu erwarten.
Das Gericht wies die Argumentation der Mutter zurück, dass die fehlende Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit gegen ein Wechselmodell spreche. Die tatsächliche Umsetzung der komplexen Umgangsregelung in den letzten Monaten habe gezeigt, dass die Eltern durchaus kooperieren können, wenn es um das Wohl der Kinder geht.
Prognose: In zusammenfassender Abwägung sei davon auszugehen, dass das Wechselmodell dem Kindeswohl im konkreten Fall am besten entspreche. Es sei prognostisch davon auszugehen, dass das Wechselmodell für die Kinder Ruhe und Stabilität bringe. Durch das Wechselmodell werde eine klare Regelung getroffen, die für die Kinder vollauf nachvollziehbar sei.
Durchsetzung
Für jeden Fall der zu vertretenden Zuwiderhandlung gegen die Umgangsregelung kann das Gericht gegenüber dem Verpflichteten folgende Maßnahmen anordnen:
• Ordnungsgeld in Höhe von jeweils bis zu 25.000 Euro
• Ordnungshaft für eine Dauer von bis zu sechs Monaten, falls das Ordnungsgeld nicht beigetrieben werden kann
• Unmittelbarer Zwang zur Vollstreckung, wenn die Festsetzung von Ordnungsmitteln erfolglos geblieben ist oder keinen Erfolg verspricht
Die Kosten des Verfahrens wurden gegeneinander aufgehoben. Der Verfahrenswert wurde auf 8.000 Euro festgesetzt.
Die Beschwerde der Mutter und der Antrag auf Aussetzung der Vollziehung
Die Mutter legte gegen den Beschluss des Amtsgerichts Traunstein Beschwerde ein und beantragte am 15. September 2025 gleichzeitig die Aussetzung der Vollziehung des Beschlusses vom 03.09.2025. Sie wollte damit erreichen, dass das Wechselmodell bis zur Entscheidung in der Hauptsache durch das Oberlandesgericht München nicht umgesetzt wird und die bisherige Regelung fortbesteht.
Begründung der Mutter
Die Mutter wiederholte und vertiefte ihre bereits in erster Instanz vorgebrachten Argumente:
Keine triftigen Gründe für Abänderung: Die Mutter vertrat die Auffassung, dass keine triftigen nachvollziehbaren Gründe für eine Abänderung im Sinne des § 1696 Abs. 1 BGB vorlägen. Die Änderung des Umgangsmodells sei minimal, so dass deswegen ein neues Verfahren nicht gerechtfertigt sei. Das Gericht habe nicht tragfähig dargelegt, dass die bewährte Struktur (6/8-Regelung) kindeswohlrelevant negativ wäre.
Etablierte Praxis: Die 6/8-Regelung bestehe seit Februar 2023 und werde mit Schulstart vor zwei Jahren in einer nur geringfügig modifizierten Bringsituation gelebt. Die Praxis sei etabliert (Schule, Rhythmus Musikschule/Freizeit, Arzttermine/Therapien). Eine abrupte Systemänderung erhöhe den Anpassungs- und Loyalitätsdruck der Kinder.
Schutz der Einbettung: Die Fortführung der bestehenden Struktur (inklusive Schulferien-Vereinbarung) bis zur OLG-Entscheidung vermeide zusätzliche Belastungen und schütze die schulische und soziale Einbettung der Kinder.
Fehlende Kooperationsbasis: Ein paritätisches Wechselmodell setze eine tragfähige Kooperations- und Kommunikationsbasis der Eltern voraus; diese fehle.
Unklarer Kindeswille: Der geäußerte Kindeswille sei alters- und reifebezogen einzuordnen. Das ältere Kind habe keinen klaren Willen geäußert. Der Wunsch des jüngeren Kindes sei auf “Gerechtigkeit” gerichtet gewesen.
Berufliche Belastung des Vaters: Der Vater sei Führungskraft und vollzeitberufstätig. Unter diesen Rahmenbedingungen sei derzeit nicht verlässlich dargetan, dass tägliche Betreuung, Pünktlichkeit zu Schule und Kursen sowie die Kontinuität der Förder- und Therapiemaßnahmen bei sofortigem 7/7-Umgangsmodell gesichert wären.
Verletzung der Stabilitätsvereinbarung: In der gerichtlich gebilligten Vereinbarung vom 06.02.2023 (Beschluss vom 13.03.2023) hätten die Eltern Stabilität bis zum 30.06.2025 vereinbart (faktische Antragssperre/Verfahrensruhe). Der Antrag des Vaters auf Abänderung erfolge vor Ablauf dieser Stabilitätsphase. Eine solche frühzeitige Abänderung widerspreche dem vereinbarten Ruhe-Korridor und sei nur zulässig, wenn triftige, das Kindeswohl nachhaltig berührende Gründe substantiiert dargelegt seien. Das sei nicht geschehen.
Geringe Eingriffsschwelle nicht erreicht: Bei einer bloßen zeitlichen Verschiebung von 6/8 auf 7/7 (“ein weiterer Tag”) sei die hohe Eingriffsschwelle nicht erreicht. Sie beantragte daher die Vollziehung auszusetzen, da die Kindeswohlbelange deutlich überwiegen.
Position des Vaters im Beschwerdeverfahren
Der Vater beantragte, den Antrag auf Aussetzung der Vollziehung zurückzuweisen.
Er führte aus, dass das Amtsgericht nachvollziehbar ausgeführt habe, dass unter Abwägung aller Kindeswohlbelange die Abänderung des Umgangsbeschlusses gemäß Vereinbarung vom 06.02.2023 aus triftigen, nachhaltig das Kindeswohl berührenden Gründen angezeigt sei.
Tatsächliches Betreuungsverhältnis: Tatsächlich zeige eine rein auf die Übernachtungsanzahl bezogene Zählweise, dass die Kinder sich nach dem Umgangsmodell des Jahres 2023 von Dienstagsabend bis Donnerstagvormittag der darauffolgenden Woche mit insgesamt neun Übernachtungen bei der Mutter und folglich mit fünf Übernachtungen von Donnerstag bis Dienstag der darauffolgenden Woche beim Vater aufhielten. Es liege dementsprechend ein 9:5-Modell vor, und die Anordnung des paritätischen Wechselmodells räume den Kindern deshalb zwei weitere Übernachtungen beim Vater ein. Dass dem Vater ursprünglich angedacht auch Betreuungszeiten in den Vormittags- und Nachmittagsstunden der Wechseltage eingeräumt worden seien, sei durch den Wegzug der Mutter faktisch unmöglich geworden.
Qualifizierte Kindeswohlprüfung: Das Amtsgericht habe in seiner Entscheidung vom 03.09.2025 im Rahmen einer qualifizierten positiven Kindeswohlprüfung anhand der Umstände des konkreten Einzelfalls geurteilt, dass die vom Vater begehrte Betreuungsform des paritätischen Wechselmodells das Kindeswohl in ausreichender Intensität berühre.
Keine Aussicht auf Erfolg: Das Rechtsmittel habe keine Aussicht auf Erfolg. Vielmehr sei davon auszugehen, dass die aktuelle Betreuungssituation völlig reibungslos funktioniere und sich die Kinder endlich ernstgenommen fühlen.
Geringe Rückkehrbelastung: Sofern sich tatsächlich im Rahmen des Beschwerdeverfahrens das paritätische Wechselmodell nicht aufrechterhalten ließe, würde eine Rückkehr in die Betreuungsform der Regelung des Jahres 2023 zumindest keine große Umstellung bedeuten.
Keine Rückkehrmöglichkeit: Betreuungsalternativen im Sinne der Rückkehr zur im Jahr 2023 festgelegten Betreuungsformel seien nicht mehr durchführbar, weil allein schon durch die Einschulung beider Kinder die ursprünglichen Betreuungsmodalitäten nicht mehr gegeben seien. Auch hätten die Eltern durch ihre Wohnortwechsel die Grundvoraussetzungen geändert, die für die Betreuungsabrede in 2023 maßgeblich gewesen seien.
Entlastung der Kinder: Durch ein klar definiertes wochenweises Wechselmodell ergebe sich für die Kinder ein einfach lebbares Betreuungsmodell, das sie entlaste und aus dem Spannungsfeld der Eltern herausnehme.
Die Entscheidung des OLG München (02.10.2025)
Das Oberlandesgericht München wies den Antrag der Mutter auf Aussetzung der Vollziehung mit Beschluss vom 02. Oktober 2025 zurück. Damit bleibt das vom Amtsgericht Traunstein angeordnete paritätische Wechselmodell sofort vollziehbar und wird weiterhin umgesetzt, auch während das Beschwerdeverfahren in der Hauptsache noch läuft.
Rechtliche Grundlage
Die Entscheidung des Senats beruht auf § 64 Abs. 3 2. Halbsatz FamFG. Danach kann das Beschwerdegericht vor der Entscheidung in der Hauptsache anordnen, dass die Vollziehung des angefochtenen Beschlusses auszusetzen ist.
In Verfahren betreffend die Regelung des Umgangsrechts kommt eine einstweilige Aussetzung der Vollziehung einer Anordnung nach §§ 1684 Abs. 2, 3, 1685 BGB durch das Beschwerdegericht in Betracht. Voraussetzung für eine Aussetzung der Vollziehung einer Umgangsregelung ist regelmäßig, dass das Rechtsmittel Aussicht auf Erfolg hat oder die Rechtslage zumindest zweifelhaft ist. Dabei sind die Erfolgsaussichten des Rechtsmittels und die drohenden Nachteile für den Rechtsbeschwerdeführer gegeneinander abzuwägen.
Begründung des OLG München
Das OLG München führte aus, dass die Beschwerde der Mutter bei summarischer Prüfung keine Aussicht auf Erfolg habe. Nachteile durch die sofortige Vollziehung der angeordneten Umgangsregelung seien zudem nicht erkennbar. Der Antrag auf vorläufige Außervollzugsetzung des erstinstanzlichen Beschlusses sei daher abzuweisen.
Voraussetzungen für Abänderung liegen vor
Das OLG München bestätigte, dass die Voraussetzungen für eine Abänderung der Umgangsvereinbarung aus 2023 vorliegen.
Rechtliche Anforderungen an Abänderung: Voraussetzung einer Änderung nach § 1696 Abs. 1 BGB sind triftige, das Kindeswohl nachhaltig berührende Gründe. Sie erfordern eine Änderung der Tatsachengrundlage oder Rechtslage nach Erlass der zu ändernden Entscheidung. Eine Änderung der Tatsachengrundlage liegt vor, wenn sich die maßgeblichen tatsächlichen Verhältnisse ändern oder Umstände, die bei der Erstentscheidung bereits vorlagen, nachträglich bekannt werden und zu einer anderen Entscheidung zwingen. Die Gründe müssen kindeswohlbezogen sein. Maßgeblich sind dabei die Grundsätze der Kontinuität und Stabilität für das Kind.
Niedrigere Änderungsschwelle bei Umgangsregelungen: Jedoch ist die Änderungsschwelle in Fragen des Umgangs niedriger anzusetzen als bei Sorgerechtsregelungen, da Umgangsregelungen in besonderem Maße der Anpassung an veränderte Lebensverhältnisse bedürfen und gegenüber einem Platzierungswechsel weniger intensiv in die Lebensverhältnisse des Kindes eingreifen.
Triftige nachhaltige Gründe gegeben: Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das Amtsgericht zutreffend triftige nachhaltige Gründe für eine Abänderung der vereinbarten Umgangsregelung gesehen, da sich die Lebensverhältnisse geändert haben. Nach den Umzügen der Beteiligten konnte der Vater seinen Betreuungsanteil nicht mehr so nutzen wie bisher, so dass er weniger Betreuungsanteil hatte, als mit der Vereinbarung beabsichtigt. Zudem hat sich durch den Schuleintritt der Kinder deren Tagesablauf geändert, woraus sich ebenfalls die Erforderlichkeit einer Anpassung ergibt.
Räumliche Voraussetzungen geschaffen: Schließlich wohnt der Vater nun in unmittelbarer Nähe der Kinder, so dass sich die Voraussetzungen für die bisherige Umgangsregelung deutlich geändert haben. Zwar ist es richtig, dass eine kontinuierliche Umgangsregelung für Stabilität sorgt. Vorliegend ist jedoch auch abzuwägen, welchen Vorteil eine geänderte Umgangsregelung für die Kinder mit sich bringt.
Kindeswunsch nach Gleichbehandlung: Die Kinder wünschen sich gleiche Betreuungsanteile durch die Eltern. Mit dem Umzug des Vaters sind die räumlichen Voraussetzungen dafür geschaffen worden. Zudem ändert sich an dem Umfeld der Kinder durch eine neue Umgangsregelung nichts. Ihre Freizeitaktivitäten und schulischen Aktivitäten können sie ungehindert fortsetzen.
Kooperationsfähigkeit als Voraussetzung
Das OLG München setzte sich ausführlich mit der Frage auseinander, ob ein paritätisches Wechselmodell eine Kooperationsfähigkeit der Eltern voraussetzt und ob diese im vorliegenden Fall gegeben ist.
Konsens nicht erforderlich: Richtig ist, dass ein paritätisches Wechselmodell die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Eltern voraussetzt. Dass zwischen den Eltern über die Betreuung des Kindes im Wechselmodell Konsens besteht, ist hingegen keine Voraussetzung für eine entsprechende Anordnung.
Kindeswille und Kindeswohl entscheidend: Das ergibt sich bereits aus der Erwägung, dass der Wille des Elternteils und das Kindeswohl nicht notwendig übereinstimmen und es auch nicht in der Entscheidungsbefugnis eines Elternteils liegt, ob eine dem Kindeswohl entsprechende gerichtliche Anordnung ergehen kann oder nicht. Würde der entgegengesetzte Wille eines Elternteils gleichsam als Vetorecht stets ausschlaggebend sein, so würde der Elternwille ohne Rücksicht auf die zugrundeliegende jeweilige Motivation des Elternteils in sachwidriger Weise über das Kindeswohl gestellt.
Faktische Kooperation nachgewiesen: Vorliegend haben die Fachkräfte und die Sachverständige überzeugend dargelegt, dass bisher ein funktionierendes System aufgebaut wurde und dass die Erweiterung des Umgangs keine weiteren Absprachen erforderlich macht. Die Sachverständige erläuterte, dass eine festgelegte Übergabezeit zu einer Entzerrung führen würde, zu weniger Hin und Her. Es würde mehr Klarheit für die Kinder entstehen. Die Kinder müssten eine grüne Linie haben.
Kindeswunsch eindeutig: Der Kindeswunsch sei, jedenfalls bei dem jüngeren Kind, gleiche Zeit bei beiden Elternteilen. Es würde zu weniger Problemen kommen, wenn ein fester Tag für die Übergaben vereinbart werden würde. Die Verfahrensbeiständin gab an, die Kinder hätten ein Recht auf beide Elternteile. Es sei ein stabiler Wunsch der Kinder nach hälfiger Aufteilung der Zeiten entstanden.
Eltern kooperieren faktisch: Die Eltern würden zwar streiten, sich aber recht schnell wieder einbremsen. Es sei außerdem nicht so, dass die Eltern sich respektlos behandeln und beleidigen würden. Es werde um die Sache gestritten, ohne verletzende gegenseitige Vorwürfe. Die Kinder haben anlässlich ihrer Anhörung nicht berichtet, dass es Streitigkeiten zwischen den Eltern gebe, die sie belasten würden.
Positive Interaktion mit Halbbruder: Die Sachverständige führte aus, dass auch die Interaktion mit dem Halbbruder, der ebenfalls beim Vater lebt, positiv gewesen sei. Die Kinder gaben an, ihn zu mögen.
Keine Nachteile durch Vollziehung erkennbar
Das OLG München stellte fest, dass Nachteile durch die sofortige Vollziehung der angeordneten Umgangsregelung nicht erkennbar seien.
Keine Gründe gegen Wechselmodell: Der Senat vermag nach jetzigem Sach- und Erkenntnisstand keine Gründe erkennen, die gegen eine Abänderung der Umgangsvereinbarung aus 2023 sprechen und die Regelung eines paritätischen Wechselmodells als nicht kindeswohldi enlich erscheinen lassen.
Kein erkennbarer Nachteil: Ein Nachteil durch die Anordnung des Sofortvollzugs und Umsetzung des paritätischen Wechselmodells bis zu einer Beschwerdeentscheidung ist nicht erkennbar. Die Kinder wünschen sich ein Wechselmodell und müssen ihren Alltag nicht belastend umstellen.
Rückkehr keine große Umstellung: Sofern sich tatsächlich im Rahmen des Beschwerdeverfahrens das paritätische Wechselmodell nicht aufrechterhalten ließe, würde eine Rückkehr in die Betreuungsform der Regelung des Jahres 2023 zumindest keine große Umstellung bedeuten. Betreuungsalternativen im Sinne der Rückkehr zur im Jahr 2023 festgelegten Betreuungsformel seien nicht mehr durchführbar, weil allein schon durch die Einschulung beider Kinder die ursprünglichen Betreuungsmodalitäten nicht mehr gegeben seien. Auch hätten die Eltern durch ihre Wohnortwechsel die Grundvoraussetzungen geändert, die für die Betreuungsabrede in 2023 maßgeblich gewesen seien.
Entlastung statt Belastung: Durch ein klar definiertes wochenweises Wechselmodell ergibt sich für die Kinder ein einfach lebbares Betreuungsmodell, das sie entlaste und aus dem Spannungsfeld der Eltern herausnehme.
Empfehlung zur Überdenken der Beschwerde
Das OLG München schloss seine Entscheidung mit einer bemerkenswerten Empfehlung an die Mutter: “Der Antragsgegnerin wird angeraten, ihre Beschwerde zu überdenken. Zwar verlangt das paritätische Wechselmodell den Eltern einiges ab, doch vorliegend entspricht es offensichtlich dem Bedürfnis der Kinder.”
Diese Formulierung macht deutlich, dass das OLG München nicht nur keine Erfolgsaussichten für die Beschwerde sieht, sondern die Mutter auffordert, ihre ablehnende Haltung im Interesse der Kinder zu überdenken.
Rechtliche Einordnung und Bedeutung
Die beiden Entscheidungen des Amtsgerichts Traunstein und des Oberlandesgerichts München sind aus mehreren Gründen von besonderer Bedeutung für die familienrechtliche Praxis:
Wechselmodell gegen den Willen eines Elternteils
Die Entscheidungen zeigen eindrucksvoll, dass Gerichte ein paritätisches Wechselmodell auch gegen den ausdrücklichen Willen eines Elternteils anordnen können, wenn dies dem Kindeswohl entspricht. Die Rechtsprechung hat sich in den letzten Jahren zunehmend vom sogenannten “Residenzmodell” (ein Elternteil als Hauptbezugsperson) hin zu einer Gleichwertigkeit beider Elternteile entwickelt.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist das Wechselmodell dann anzuordnen, wenn die geteilte Betreuung durch beide Eltern im Vergleich mit anderen Betreuungsmodellen dem Kindeswohl im konkreten Fall am besten entspricht. Als gewichtige Gesichtspunkte des Kindeswohls hat der BGH die Erziehungseignung der Eltern, die Bindungen des Kindes, die Prinzipien der Förderung und der Kontinuität sowie die Beachtung des Kindeswillens angeführt.
Das OLG München stellt in seiner Entscheidung klar, dass der entgegengesetzte Wille eines Elternteils nicht als Vetorecht wirken kann. Würde der entgegengesetzte Wille eines Elternteils gleichsam als Vetorecht stets ausschlaggebend sein, so würde der Elternwille ohne Rücksicht auf die zugrundeliegende jeweilige Motivation des Elternteils in sachwidriger Weise über das Kindeswohl gestellt.
Bedeutung des Kindeswillens
Der vorliegende Fall unterstreicht die zentrale Bedeutung des Kindeswillens bei Umgangsentscheidungen. Beide Kinder hatten klar und übereinstimmend geäußert, dass sie sich eine paritätische Zeitverteilung wünschen. Beide Gerichte folgten diesem Willen, nachdem sie sich durch das Sachverständigengutachten und die Stellungnahme der Verfahrensbeiständin davon überzeugt hatten, dass dieser Wille nicht durch elterliche Beeinflussung zustande gekommen war.
Nach § 1626 Abs. 2 BGB haben die Eltern bei der Pflege und Erziehung die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewusstem Handeln zu berücksichtigen. Bei einem neunjährigen und einem siebenjährigen Kind ist der Kindeswille bereits ein gewichtiger Faktor, insbesondere wenn er so klar und übereinstimmend geäußert wird wie im vorliegenden Fall.
Das OLG München betont, dass der Kindeswunsch eindeutig sei, jedenfalls bei dem jüngeren Kind, gleiche Zeit bei beiden Elternteilen zu verbringen. Die Verfahrensbeiständin habe festgestellt, dass es ein stabiler Wunsch der Kinder nach hälfiger Aufteilung der Zeiten sei.
Kooperationsfähigkeit als Voraussetzung
Ein häufig diskutierter Aspekt beim Wechselmodell ist die Frage, inwieweit eine funktionierende Kommunikation und Kooperation zwischen den Eltern Voraussetzung für ein solches Modell ist. Der vorliegende Fall zeigt, dass Gerichte nicht eine perfekte Kommunikation verlangen, sondern eine ausreichende Kooperationsfähigkeit auf der praktischen Ebene.
Das OLG München stellt klar: “Richtig ist, dass ein paritätisches Wechselmodell die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Eltern voraussetzt. Dass zwischen den Eltern über die Betreuung des Kindes im Wechselmodell Konsens besteht, ist hingegen keine Voraussetzung für eine entsprechende Anordnung.”
Beide Gerichte stellten fest, dass die Eltern in den letzten zehn Monaten ein komplexes Umgangskonzept erfolgreich umgesetzt hatten. Dies zeigte, dass sie trotz des bestehenden Konflikts in der Lage waren, zum Wohle der Kinder zusammenzuwirken. Das Amtsgericht betonte, dass durch ein Wechselmodell mit klaren Strukturen sich in Zukunft viele Unstimmigkeiten, die durch die komplexe Umgangsregelung entstanden waren, gar nicht erst ergeben würden.
Das OLG München führt aus, dass die Fachkräfte und die Sachverständige überzeugend dargelegt hätten, dass bisher ein funktionierendes System aufgebaut wurde und dass die Erweiterung des Umgangs keine weiteren Absprachen erforderlich macht. Die Eltern würden zwar streiten, sich aber recht schnell wieder einbremsen. Es sei außerdem nicht so, dass die Eltern sich respektlos behandeln und beleidigen würden. Es werde um die Sache gestritten, ohne verletzende gegenseitige Vorwürfe.
Veränderte Rahmenbedingungen als Abänderungsgrund
Der Fall illustriert, dass wesentliche Veränderungen der äußeren Umstände eine Abänderung bestehender Umgangsregelungen rechtfertigen können. Die räumliche Annäherung der Eltern und der gemeinsame Schulbesuch der Kinder schufen eine neue Sachlage, die eine Neubewertung der Umgangsregelung erforderlich machte.
Nach § 1696 Abs. 1 BGB kann das Familiengericht eine Entscheidung zur elterlichen Sorge oder zum Umgangsrecht ändern, wenn dies aus triftigen, das Wohl des Kindes nachhaltig berührenden Gründen angezeigt ist. Die Rechtsprechung verlangt hierfür eine wesentliche Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse oder der rechtlichen Rahmenbedingungen, die bei der ursprünglichen Entscheidung noch nicht vorlagen oder nicht absehbar waren.
Das OLG München bestätigt, dass die Änderungsschwelle in Fragen des Umgangs niedriger anzusetzen ist als bei Sorgerechtsregelungen, da Umgangsregelungen in besonderem Maße der Anpassung an veränderte Lebensverhältnisse bedürfen und gegenüber einem Platzierungswechsel weniger intensiv in die Lebensverhältnisse des Kindes eingreifen.
Das OLG führt aus, dass nach den Umzügen der Beteiligten der Vater seinen Betreuungsanteil nicht mehr so nutzen konnte wie bisher, so dass er weniger Betreuungsanteil hatte, als mit der Vereinbarung beabsichtigt. Zudem habe sich durch den Schuleintritt der Kinder deren Tagesablauf geändert, woraus sich ebenfalls die Erforderlichkeit einer Anpassung ergebe. Schließlich wohne der Vater nun in unmittelbarer Nähe der Kinder, so dass sich die Voraussetzungen für die bisherige Umgangsregelung deutlich geändert hätten.
Stabilitätsvereinbarungen und vorzeitige Abänderung
Ein besonderer Aspekt des Falls ist die Frage, ob eine Stabilitätsvereinbarung, in der sich die Eltern verpflichten, für einen bestimmten Zeitraum keine neuen Anträge zu stellen, eine vorzeitige Abänderung ausschließt.
Die Gerichte haben klargestellt, dass solche Vereinbarungen zwar grundsätzlich zu beachten sind, aber nicht verhindern können, dass bei wesentlich veränderten Umständen eine Abänderung beantragt und durchgesetzt werden kann. Die Stabilitätsvereinbarung kann nicht dazu führen, dass eine kindeswohlrelevante Anpassung der Umgangsregelung unterbleibt, wenn sich die Rahmenbedingungen grundlegend geändert haben.
Das Amtsgericht führte aus, dass nachdem sich die Wohnsituation komplett geändert habe, keine Gründe ersichtlich seien, warum an der Verpflichtung, innerhalb von zwei Jahren keinen Neuantrag zu stellen, festgehalten werden solle. Das OLG München bestätigte diese Auffassung implizit, indem es die Abänderung trotz der noch laufenden Stabilitätsphase als rechtmäßig ansah.
Aussetzung der Vollziehung im Beschwerdeverfahren
Die Entscheidung des OLG München zur Aussetzung der Vollziehung ist ebenfalls von großer praktischer Bedeutung. Sie zeigt, dass eine Aussetzung nur dann in Betracht kommt, wenn das Rechtsmittel Aussicht auf Erfolg hat oder die Rechtslage zumindest zweifelhaft ist.
Das OLG München stellte fest, dass die Beschwerde der Mutter bei summarischer Prüfung keine Aussicht auf Erfolg habe und dass Nachteile durch die sofortige Vollziehung der angeordneten Umgangsregelung nicht erkennbar seien. Im Gegenteil: Die Kinder wünschten sich ein Wechselmodell und müssten ihren Alltag nicht belastend umstellen.
Das Gericht führte aus, dass sofern sich tatsächlich im Rahmen des Beschwerdeverfahrens das paritätische Wechselmodell nicht aufrechterhalten ließe, eine Rückkehr in die Betreuungsform der Regelung des Jahres 2023 zumindest keine große Umstellung bedeuten würde. Zudem seien Betreuungsalternativen im Sinne der Rückkehr zur im Jahr 2023 festgelegten Betreuungsformel nicht mehr durchführbar, weil allein schon durch die Einschulung beider Kinder die ursprünglichen Betreuungsmodalitäten nicht mehr gegeben seien.
Minimale Änderung oder wesentliche Umstellung?
Ein interessanter Aspekt der Argumentation ist die Frage, ob die Änderung von einem 6/8-Modell (bzw. faktisch 5/9-Modell bei Betrachtung der Übernachtungen) zu einem 7/7-Modell eine minimale oder eine wesentliche Änderung darstellt.
Die Mutter argumentierte, dass die Änderung minimal sei (“ein weiterer Tag”) und daher die hohe Eingriffsschwelle des § 1696 Abs. 1 BGB nicht erreicht sei. Der Vater und die Gerichte sahen dies anders: Der Vater wies darauf hin, dass faktisch ein 9:5-Modell vorliege und die Anordnung des paritätischen Wechselmodells den Kindern zwei weitere Übernachtungen beim Vater einräume. Zudem sei durch den Wegzug der Mutter die ursprünglich vorgesehene Betreuung in den Vormittags- und Nachmittagsstunden faktisch unmöglich geworden.
Die Gerichte betonten, dass es nicht nur um die reine Anzahl der Tage gehe, sondern auch um die symbolische Bedeutung der Gleichbehandlung für die Kinder. Die Kinder hätten ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und wünschten sich eine paritätische Aufteilung. Dieser Wunsch sei für das Kindeswohl von zentraler Bedeutung.
Praktische Hinweise für betroffene Eltern
Diese Entscheidungen bieten wichtige Erkenntnisse für Eltern, die sich in einer ähnlichen Situation befinden:
Für Eltern, die ein Wechselmodell anstreben
Dokumentieren Sie veränderte Umstände: Wenn sich die äußeren Rahmenbedingungen wesentlich verändert haben (z.B. durch Umzug, Schulwechsel), dokumentieren Sie diese Veränderungen sorgfältig. Der vorliegende Fall zeigt, dass solche Veränderungen auch eine Abänderung vor Ablauf vereinbarter Stabilitätsphasen rechtfertigen können.
Zeigen Sie Kooperationsbereitschaft: Auch wenn der Konflikt mit dem anderen Elternteil besteht, ist es wichtig, auf der praktischen Ebene Kooperationsfähigkeit zu zeigen. Die erfolgreiche Umsetzung komplexer Umgangsregelungen kann ein starkes Argument für ein Wechselmodell sein. Im vorliegenden Fall war die Tatsache, dass die Eltern in den letzten zehn Monaten ein komplexes Umgangskonzept erfolgreich umgesetzt hatten, ein zentrales Argument für die Anordnung des Wechselmodells.
Hören Sie auf die Kinder: Wenn Ihre Kinder den Wunsch nach mehr Zeit mit Ihnen äußern, nehmen Sie dies ernst. Der Kindeswille ist ein gewichtiger Faktor bei Umgangsentscheidungen. Im vorliegenden Fall war der eindeutige und übereinstimmende Wunsch beider Kinder nach einer paritätischen Zeitverteilung ein entscheidendes Argument.
Schaffen Sie optimale Rahmenbedingungen: Sorgen Sie für eine angemessene Wohnung, zeitliche Flexibilität und die Möglichkeit, die Kinder in ihrem gewohnten Umfeld (Schule, Freunde, Hobbys) zu betreuen. Im vorliegenden Fall waren die optimalen äußeren Rahmenbedingungen (kurze Entfernung, gleiche Schule, Homeoffice) ein wichtiges Argument.
Holen Sie fachliche Unterstützung: Ein Sachverständigengutachten oder die Stellungnahme eines Verfahrensbeistands können entscheidend sein. Arbeiten Sie konstruktiv mit diesen Fachpersonen zusammen. Im vorliegenden Fall waren die übereinstimmenden Empfehlungen der Verfahrensbeiständin, der Sachverständigen und des Jugendamts von großer Bedeutung.
Argumentieren Sie präzise: Wenn Sie argumentieren, dass die bisherige Regelung nicht mehr dem Kindeswohl entspricht, seien Sie präzise. Der Vater im vorliegenden Fall konnte überzeugend darlegen, dass er durch die Umzüge und die Kurszeiten faktisch weniger Betreuungszeit hatte als ursprünglich vorgesehen.
Beantragen Sie gegebenenfalls sofortige Vollziehung: Wenn Sie ein Wechselmodell durchsetzen, kann es sinnvoll sein, die sofortige Vollziehung zu beantragen oder sich gegen eine Aussetzung der Vollziehung im Beschwerdeverfahren zu wehren. Der vorliegende Fall zeigt, dass Gerichte eine Aussetzung ablehnen, wenn die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg hat und keine Nachteile durch die sofortige Vollziehung erkennbar sind.
Für Eltern, die ein Wechselmodell ablehnen
Benennen Sie konkrete kindeswohlbezogene Gründe: Allgemeine Vorwürfe gegen den anderen Elternteil oder pauschale Behauptungen über fehlende Kooperationsfähigkeit reichen nicht aus. Sie müssen konkret darlegen, warum ein Wechselmodell dem Kindeswohl widerspricht. Im vorliegenden Fall konnte die Mutter keine überzeugenden kindeswohlbezogenen Gründe nennen.
Seien Sie ehrlich zur Kooperationsfähigkeit: Wenn Sie in der Vergangenheit erfolgreich mit dem anderen Elternteil bei der Umsetzung von Umgangsregelungen kooperiert haben, wird es schwer sein, mangelnde Kooperationsfähigkeit als Argument gegen ein Wechselmodell anzuführen. Im vorliegenden Fall wurde die Argumentation der Mutter, dass die Kooperationsfähigkeit fehle, durch die Tatsache widerlegt, dass die Eltern in den letzten zehn Monaten ein komplexes Umgangskonzept erfolgreich umgesetzt hatten.
Respektieren Sie den Kindeswillen: Wenn Ihre Kinder einen klaren Wunsch nach mehr Zeit mit dem anderen Elternteil äußern, sollten Sie diesen Wunsch ernst nehmen. Versuche, die Kinder zu beeinflussen oder ihren Willen herunterzuspielen, werden von Gerichten und Sachverständigen erkannt. Im vorliegenden Fall war der eindeutige Kindeswille ein zentrales Argument gegen die Position der Mutter.
Konzentrieren Sie sich auf das Kindeswohl: Ihre Argumentation sollte sich ausschließlich auf das Wohl der Kinder konzentrieren, nicht auf Ihre eigenen Interessen oder Konflikte mit dem anderen Elternteil. Unterstellungen wirtschaftlicher Motive, wie im vorliegenden Fall, sind in der Regel nicht hilfreich.
Bedenken Sie die Folgen einer Verweigerungshaltung: Das OLG München hat der Mutter empfohlen, ihre Beschwerde zu überdenken, da das Wechselmodell offensichtlich dem Bedürfnis der Kinder entspreche. Eine fortgesetzte Verweigerungshaltung gegen ein kindeswohlgerechtes Wechselmodell kann sich negativ auf Ihre Position in weiteren Verfahren auswirken.
Prüfen Sie Alternativen zur Beschwerde: Wenn ein erstinstanzliches Gericht ein Wechselmodell angeordnet hat und die Fachpersonen dies befürworten, überlegen Sie sorgfältig, ob eine Beschwerde Aussicht auf Erfolg hat. Der vorliegende Fall zeigt, dass das OLG München die Beschwerde als aussichtslos ansah und empfahl, sie zu überdenken.
Seien Sie realistisch bei Aussetzungsanträgen: Ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung im Beschwerdeverfahren hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn das Rechtsmittel Erfolgsaussichten hat oder die Rechtslage zumindest zweifelhaft ist. Im vorliegenden Fall lehnte das OLG München den Aussetzungsantrag ab, weil die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg hatte.
Allgemeine Empfehlungen
Außergerichtliche Einigung anstreben: Auch wenn die Fronten verhärtet erscheinen, sollten Sie versuchen, eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Mediation oder Beratung durch das Jugendamt können hilfreich sein. Im vorliegenden Fall hatten die Eltern zunächst eine Vereinbarung getroffen, die aber aufgrund veränderter Umstände nicht mehr funktionierte.
Professionelle Beratung einholen: Lassen Sie sich von einem auf Familienrecht spezialisierten Rechtsanwalt beraten. Die Rechtslage zum Wechselmodell ist komplex und entwickelt sich ständig weiter. Die vorliegenden Entscheidungen zeigen, dass die Gerichte zunehmend bereit sind, Wechselmodelle auch gegen den Willen eines Elternteils anzuordnen, wenn dies dem Kindeswohl entspricht.
An die Kinder denken: Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens sollten Sie immer das Wohl Ihrer Kinder im Blick behalten. Elternkonflikte belasten Kinder erheblich. Versuchen Sie, auf der Elternebene zu kooperieren, auch wenn die persönliche Beziehung schwierig ist. Im vorliegenden Fall betonten die Kinder, dass sie sich wünschten, dass die Eltern sich nicht mehr streiten würden.
Stabilitätsvereinbarungen realistisch einschätzen: Stabilitätsvereinbarungen, in denen sich Eltern verpflichten, für einen bestimmten Zeitraum keine neuen Anträge zu stellen, können sinnvoll sein. Sie verhindern aber nicht, dass bei wesentlich veränderten Umständen eine Abänderung beantragt und durchgesetzt werden kann. Seien Sie sich bewusst, dass solche Vereinbarungen nicht absolut sind.
Flexibilität bei veränderten Umständen: Wenn sich die Rahmenbedingungen wesentlich ändern (Umzug, Schulwechsel, berufliche Veränderungen), seien Sie bereit, die Umgangsregelung anzupassen. Eine starre Haltung kann dazu führen, dass eine gerichtliche Auseinandersetzung unvermeidlich wird. Im vorliegenden Fall hätte eine frühzeitige Bereitschaft der Mutter, die Umgangsregelung an die veränderten Umstände anzupassen, möglicherweise ein Gerichtsverfahren vermeiden können.
Fazit
Die Beschlüsse des Amtsgerichts Traunstein vom 03. September 2025 und des Oberlandesgerichts München vom 02. Oktober 2025 sind wegweisende Entscheidungen zum paritätischen Wechselmodell. Sie machen deutlich, dass ein solches Modell auch gegen den Willen eines Elternteils angeordnet werden kann, wenn dies dem Kindeswohl am besten entspricht.
Entscheidend für die Anordnung eines Wechselmodells sind:
• Die Bindungsqualität der Kinder zu beiden Elternteilen
• Die Erziehungsfähigkeit beider Eltern
• Die äußeren Rahmenbedingungen (räumliche Nähe, Schule, Flexibilität)
• Die Kooperationsfähigkeit der Eltern auf der praktischen Ebene
• Der Kindeswille, insbesondere bei älteren Kindern
Die Entscheidungen zeigen auch, dass Gerichte nicht eine perfekte Kommunikation zwischen den Eltern verlangen, sondern eine ausreichende Kooperationsfähigkeit auf der praktischen Ebene. Die erfolgreiche Umsetzung komplexer Umgangsregelungen kann ein starkes Indiz dafür sein, dass ein Wechselmodell funktionieren kann.
Besonders bemerkenswert ist die Klarstellung des OLG München, dass der entgegengesetzte Wille eines Elternteils nicht als Vetorecht wirken kann. Das Kindeswohl steht im Vordergrund, nicht die Wünsche oder Befindlichkeiten der Eltern.
Für betroffene Eltern ist es wichtig, sich auf das Kindeswohl zu konzentrieren und nicht auf eigene Interessen oder Konflikte mit dem anderen Elternteil. Der Kindeswille ist ein gewichtiger Faktor, der von Gerichten ernst genommen wird. Eltern sollten versuchen, auf der praktischen Ebene zu kooperieren, auch wenn die persönliche Beziehung schwierig ist.
Das paritätische Wechselmodell ist kein Allheilmittel und nicht in jedem Fall die beste Lösung. Es erfordert Engagement, Flexibilität und Kooperationsbereitschaft von beiden Elternteilen. Wenn diese Voraussetzungen aber gegeben sind, kann es eine gute Möglichkeit sein, beiden Elternteilen eine gleichwertige Beziehung zu ihren Kindern zu ermöglichen und dem Gerechtigkeitsempfinden der Kinder Rechnung zu tragen.
Die Empfehlung des OLG München an die Mutter, ihre Beschwerde zu überdenken, macht deutlich, dass Gerichte von Eltern erwarten, dass sie ihre Position im Lichte des Kindeswohls überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Eine fortgesetzte Verweigerungshaltung gegen ein kindeswohlgerechtes Wechselmodell ist nicht im Interesse der Kinder und wird von den Gerichten nicht unterstützt.
Rechtliche Grundlagen
§ 1696 Abs. 1 BGB – Abänderung gerichtlicher Entscheidungen und gerichtlich gebilligter Vergleiche
Das Familiengericht kann eine Entscheidung zur elterlichen Sorge oder zum Umgangsrecht ändern, wenn dies aus triftigen, das Wohl des Kindes nachhaltig berührenden Gründen angezeigt ist.
§ 1684 BGB – Umgang des Kindes mit den Eltern
(1) Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil; jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind berechtigt und verpflichtet.(2) Die Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert. Entsprechendes gilt, wenn sich das Kind in der Obhut einer anderen Person befindet.
§ 1697a BGB – Kindeswohlprinzip
Soweit nichts anderes bestimmt ist, trifft das Gericht in Verfahren über die in diesem Titel geregelten Angelegenheiten diejenige Entscheidung, die unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten sowie der berechtigten Interessen der Beteiligten dem Wohl des Kindes am besten entspricht.
§ 64 Abs. 3 FamFG – Aussetzung der Vollziehung
Das Beschwerdegericht kann vor der Entscheidung in der Hauptsache anordnen, dass die Vollziehung des angefochtenen Beschlusses auszusetzen ist.
Hinweis
Dieser Artikel dient ausschließlich der allgemeinen Information und stellt keine Rechtsberatung dar.
Schlagwörter
Wechselmodell, Paritätisches Wechselmodell, Umgangsrecht, Kindeswille, § 1696 BGB, Kindeswohl, Kindesanhörung, Sachverständigengutachten, Kooperationsfähigkeit, Stabilitätsvereinbarung

In unserer renommierten Anwaltskanzlei sind wir auf sämtliche Aspekte des Familienrechts spezialisiert. Mit Jörg Schröck, einem versierten Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht, gehören wir zu den führenden Experten für familiäre Rechtsangelegenheiten und Scheidungen. Unsere fundierte Beratung richtet sich besonders an Freiberufler, Unternehmer und Selbstständige in diversen Berufsfeldern wie Medizin, Architektur, IT und Ingenieurwesen, insbesondere in Bezug auf Unterhaltsfragen, Vermögensauseinandersetzung und Steuerrecht. Dank unserer langjährigen Erfahrung von über 20 Jahren können Sie auf unsere kompetente und zuverlässige juristische Unterstützung zählen.

Kompetenzen in Sachen Verfahrensstrategie und Rechtsanalyse
Überregional und unabhängig: Wir arbeiten ganz bewusst überregional, um unabhängig vom Wohlwollen einer örtlichen Richterschaft zu sein.
Eigenschaften: durchsetzungsstark – erfahren – clever
Referenzen: Unsere Referenzen sprechen für die Qualität unserer Arbeit.